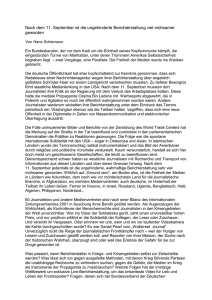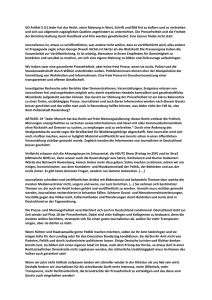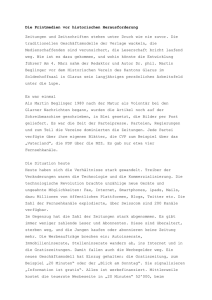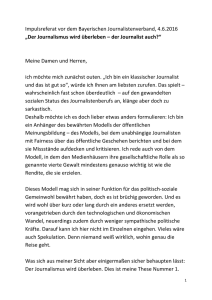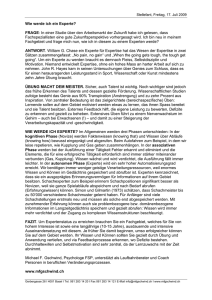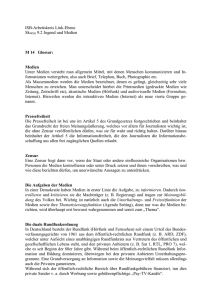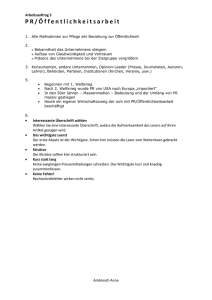2. THEORIE 2.1. Psychologie in der Öffentlichkeit - diss.fu
Werbung

Theorie 21 2. THEORIE 2.1. Psychologie in der Öffentlichkeit und in den Medien Medien haben einen hohen Bedarf an psychologiehaltigen journalistischen Produkten (Sydow, Weber & Reimer, 1998). Dieser Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen (Schorr, 1994a/b). Das wachsende Interesse der Medien an psychologischen Themen wird von den Vertretern des Faches positiv bewertet (Foppa, 1989). Insbesondere die Humanwissenschaften Medizin und Psychologie stehen bei Journalisten hoch im Kurs (Böhme-Dürr & Grube, 1989). Psychologische und medizinische Themen lassen sich leicht personalisieren, d.h. anhand von Fallgeschichten "erzählen". Sie zeichnen sich durch das aus, was Medienwissenschaftler einen „human touch“ nennen (Deneke, 1992; Fischer, 1992). Dank eines solchen journalistischen Gestaltungsmittels ist es möglich, mit diesen Themen einen Bezug zur Alltags- und Lebenswelt von Rezipienten herzustellen. Dadurch erfüllen diese Themen in der Regel das journalistische Selektionskriterium der Relevanz bzw. der Betroffenheit (Mast, 2000). Abbildung1: Medienpräsenz psychologischer Themen [entnommen aus: Böhme-Dürr & Grube, 1989, S. 451] Soziologie Psychologie 12% 21% Ethnologie 11% Geschichte 7% andere Politologie 6% Pädagogik 6% 20% Sprachwiss. Publizistik 6% 6% Ökonomie 5% Die hohe Medienpräsenz der Psychologie hat allerdings bisher nicht zu einem gesteigerten öffentlichen Ansehen des Faches geführt (Rietz & Wahl, 1997). Psychologie hat nach wie vor ein Image- und Glaubwürdigkeitsproblem (Guggenberger, 1990; Sander, 1998; Burghofer, 2000). Die mediale Berichterstattung hat daran nichts zu ändern vermocht Kirschner, 1997). Hierfür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Theorie 22 1. Lediglich 3% der psychologiehaltigen Berichterstattung wird im Ressort Wissenschaft veröffentlicht. Aus diesem Grund ist es für Rezipienten kaum möglich, das wissenschaftliche Fundament der Profession Psychologie zu erkennen (s. Schorr, 1994a/b). 2. Obgleich psychologische Themen in vielen (Fernseh- und Hörfunk-)Formaten bzw. in vielen Print- Ressorts vorkommen, wird das Fach in der medialen Berichterstattung zumeist auf seinen klinisch-therapeutischen Aspekt verengt. Deshalb ist es für Rezipienten kaum möglich, ein umfassendes und realistisches Bild vom Forschungsfeld Psychologie zu entwickeln (s. Böhme-Dürr & Grube, 1989). Das medial vermittelte öffentliche Bild der Wissenschaft Psychologie und ihrer Vertreter weicht erheblich vom Selbstbild der Profession ab. Dieser Zustand erzeugt nach Ansicht von Schorr (1994a) bei Psychologinnen und Psychologen kognitive Dissonanz. So beklagen wissenschaftlich tätige Psychologinnen und Psychologen denn auch die mangelhafte Güte psychologiehaltiger Berichterstattung. Sie sehen in der fehlenden Fachkompetenz von Journalisten den Hauptgrund für die als unbefriedigend wahrgenommene Berichterstattung (Jaeggi, 1997). Folgt man den Forschungsergebnissen von McCall (1988), so kann das Verhältnis zwischen Journalisten und Psychologie-Experten als ein kritisch- distanziertes beschrieben werden, das durch wechselseitige Vorbehalte gekennzeichnet ist. Die Haltung wissenschaftlich tätiger Psychologinnen und Psychologen gegenüber den Medien ist alles andere als untypisch. Denn das Verhältnis von Wissenschaftlern und Journalisten ist nach den Erkenntnissen von Haller (1987; 1992) und Hömberg (1990; 1992) prekär, spannungsreich und von zahlreichen wechselseitigen Missverständnissen geprägt. Allerdings hat Peters (1995) nachweisen können, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden Funktionssystemen Wissenschaft und Medien in den letzten Jahren verbessert hat. Abbildung2: Die Qualität der Wissenschaftsberichterstattung aus Sicht von Wissenschaftlern [entnommen aus den Materialien des Medientrainings v. Peters & Göpfert] 37% 26% 44% 53% 53% 52% 39% 42% 4% 8% 4% FZ Jülich (1997) FU Berlin (1997) Experten (1993) 49% 53% 10% U Mainz 26% KFA Jülich (1984) Eher gut Teils, teils Eher schlecht Theorie 23 Wissenschaftler weisen immer wieder auf die Unzulänglichkeiten des Journalismus hin (Krüger, 1987; Reschenberg, 1989). Sie vertreten mehrheitlich die Auffassung, dass der Journalismus kaum imstande sei, wissenschaftlich fundierte Sachverhalte präzise und korrekt darzustellen. Ferner versage der Journalismus vollends, wenn es darum gehe, wissenschaftliche Erkenntnisse zu bewerten und einzuschätzen. Umgekehrt weisen Journalisten darauf hin, dass sich der Journalismus nicht nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilen lasse, sondern über eigene - eben journalistische Bewertungskriterien verfüge (Hömberg, 1987, 1990; Kastner, 1994). Zwar stimmen Wissenschaftler und Journalisten darin überein, dass die Berichterstattung über Wissenschaft primär dazu dienen sollte, Fakten zu vermitteln und praktische Ratschläge (Orientierungshilfen) zu erteilen; die Notwendigkeit, über wissenschaftliche Themen kritisch bzw. investigativ zu berichten, wird jedoch nur von den Journalisten gesehen, nicht aber von den Wissenschaftlern. Nur 38 Prozent der Wissenschaftler billigen dem Wissenschaftsjournalismus eine Kontrollfunktion zu (Krüger, 1987, S. 48). Aus Sicht von Journalisten sind Wissenschaftler nicht befugt, die publizistische Qualität journalistischer Produkte zu beurteilen, da sie die Aufgaben des Journalismus auf "Wissenstransfer" und "Aufklärung" reduziert sehen wollen, ohne dabei zu erkennen, dass Journalisten darüber hinaus die Aufgabe zukommt, das System Wissenschaft zu kontrollieren und zu kritisieren (Haux, 1989; Bader, 1993). Wissenschaftler und Journalisten verfolgen demnach unterschiedliche Ziele. Diese unterschiedliche Prioritätensetzung ist interessensbedingt und lässt sich nicht so ohne weiteres auflösen. Sie erklärt sich aus der Struktur der beiden Systeme und ist folglich mehr als nur ein Kommunikationsproblem, worauf z. B. Göpfert & Peters (1995) hinweisen. Gleichwohl müsste es möglich sein, zwischen Wissenschaftlern und Journalisten eine Form professionellen Zusammenarbeitens zu entwickeln, wie sie sich z.B. zwischen Journalismus und Politik bereits etabliert hat (Schaller, 1988; Patzelt, 1991). Allerdings sind wissenschaftliche Themen nicht einfach zu „vermitteln“; das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Medien ist durch einige Kommunikationsbarrieren gekennzeichnet, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlichen soll. Theorie 24 Tabelle1: Mögliche „Schwierigkeiten“ bei der medialen Vermittlung eines wissenschaftlichen Themas [Wissenschaftsspezifische Vermittlungsproblematik] 1. Wissenschaftler sehen sich gerne in der Rolle des „Lehrers“ bzw. „Erziehers“; ihn fällt es jedoch schwer, klare und unmissverständliche Wertungen bzw. Einschätzungen vorzunehmen. Journalisten wünschen sich von Wissenschaftlern jedoch, dass sie stärker die Rolle des „Mahners“ bzw. die Rolle des „Schiedsrichters“ einnehmen als sie das zu tun bereit sind. 2. Wissenschaftler neigen dazu, sich „nach allen Seiten“ abzusichern; sie schränken den Geltungsbereich einer wissenschaftlichen These häufig sehr stark ein bzw. sie spezifizieren Ausnahmebedingungen, unter denen eine These nicht gültig ist. Journalisten blenden diese „Einschränkungen“ gerne aus, um eine aussagkräftige These präsentieren zu können. 3. Wissenschaftler sind sehr daran interessiert, über die „Inhalte“ ihrer Forschung zu reden. Journalisten interessieren sich hingegen eher für die ethisch- gesellschaftlichen oder praktischen Folgen, die sich aus einem Forschungsbefund ergeben. 4. Wissenschaftler sind es gewohnt, ihre eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse „zu verstecken“; sie stellen die „Originalität“ eines Ergebnisses nicht gesondert heraus, sondern ordnen dieses Ergebnis in einen Forschungskontext ein. Journalisten interessieren sich weniger für den wissenschaftsimmanenten Entstehungskontext eines Forschungsbefundes, sondern eher für die „Originalität“ bzw. „Neuheit“ eines Forschungsresultates. Folglich blenden sie den Entstehungskontext für gewöhnlich aus. 5. Wissenschaftler neigen dazu, die Entwicklung auf einem Forschungsfeld als Prozess steten Fortschrittes zu idealisieren; indem sie selektiv nur „positive“ Befunde schildern, „verkaufen“ sie die Illusion eines ungebrochenen und kontinuierlichen Fortschrittes. Journalisten sollten ihre Aufgabe darin sehen, diese „Erfolgsgeschichte“ als Idealisierung zu enttarnen. 6. Wissenschaftler zeichnen ein nüchternes Bild ihrer Arbeit und neigen nicht dazu, ihre Forschungstätigkeit zu überhöhen oder zu personalisieren. Journalisten sind hingegen daran interessiert, Wissenschaft als etwas Spektakuläres und Überraschendes zu stilisieren („Wissenschaft als Abenteuer“). Wissenschaftler und Journalisten entstammen unterschiedlichen „Welten“. Dennoch steht der Wissenschaftsjournalismus unter dem Generalverdacht, unkritische „Hofberichterstattung“ zu betreiben (Göpfert & Ruß-Mohl, 1996). Vielfach wird die fachliche Nähe von Wissenschaftsjournalisten zum System „Wissenschaft“ dafür verantwortlich gemacht, dass die Berichterstattung schönfärberisch und PR- lastig ausfällt. Eine andere Ursache könnte darin liegen, dass über wissenschaftliche Themen nur dann berichtet wird, wenn es Fortschritte und Erfolge zu vermelden gibt. Das Selektionskriterium, nach denen Wissenschaftsthemen ausgesucht werden, unterscheidet sich folglich von jenem, das in der Politik- oder Wirtschaftsberichterstattung gültig ist. Im Wissenschaftsjournalismus ist das sonst übliche Prinzip „auf den Kopf gestellt“, es gilt: Nur gute Nachrichten sind echte Nachrichten. Lediglich bei sehr relevanten und „gut eingeführten“ Themen (z. B. Krebsforschung) Theorie 25 ist es u. U. möglich, kritisch zu berichten und einen Forschungsstillstand zu thematisieren. Die Verantwortung für diesen Missstand trägt nicht allein das System „Medien“; vielmehr ist es so, dass die Medien lediglich einen bestimmten Selektionsmechanismus verstärken bzw. „doppeln“, der im System „Wissenschaft“ bereits angelegt ist: Denn auch innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs werden selektiv v. a. positive Ergebnisse publiziert. In den wissenschaftlichen Fachzeitschriften sucht man vergeblich nach „fehlenden Signifikanzen“ oder „uneffektiven Behandlungsmethoden“. So wenig das System Wissenschaft die „Falsifikation“ von Theorien honoriert, so wenig schätzt das System Medien die „Falsifikation“ wissenschaftlicher Erfolgsmeldungen. Auf diese Weise arbeiten sich beide Systeme zu und erzeugen den Eindruck als ginge es in der Wissenschaft stetig aufwärts. Dem System Wissenschaft wird ein höheres Vertrauen entgegen gebracht als dem System Medien (Krüger, 1987). In Anlehnung an Kohring (2003; 2004) lässt sich deshalb annehmen, dass den innerwissenschaftlichen Mechanismen der Selektion von Fakten sowie der selektiven Gewichtung von Fakten eher vertraut wird als den innerjournalistischen Selektionsmechanismen. Wissenschaftler beurteilen die Wissenschaftsberichterstattung kritisch, aber nicht durchweg negativ. Die Qualität der Berichterstattung über „hard sciences“ schätzen Wissenschaftler höher ein als jene über „soft sciences“, zu denen auch die Psychologie zu rechnen ist. Während die Medienvertreter nachweislich ein großes Interesse an Psychologie-Themen haben, begegnet die Öffentlichkeit dem Erkenntnisgegenstand Psychologie eher mit Zurückhaltung bzw. Skepsis (Sander, 1998). Die kritische Haltung von Psychologinnen und Psychologen gegenüber den Medien ist insofern nachvollziehbar als dass die Medien nicht dazu beigetragen haben, das Ansehen des Faches Psychologie zu erhöhen. Aus Sicht der Profession wäre es wünschwert, wenn Psychologie in seiner vollen thematischen Breite öffentlich wahrgenommen und als eigenständige und wissenschaftsgeleitete Profession dargestellt würde. Trotz eines gewachsenen Bedarfs an populärwissenschaftlichen Formaten (Issing, 1990) ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Medien einen solchen Image-Wandel des Faches anzustoßen bereit bzw. imstande sind. Vielmehr bedarf es hierfür eines gesteigerten Medien-Engagements auf Seiten der Fachvertreter (Mreschar, 1989). Dem Beruf des Psychologen wird zugleich Bewunderung und Geringschätzung entgegen gebracht; das Bild der Öffentlichkeit ist ambivalent (BDP, 1996). Am grundlegenden Imageproblem der Psychologie hat sich in den letzten 30 Jahren nicht sonderlich viel geändert, wie zahlreiche Studien belegen (Thumin & Zebelmann, 1967; Benjamin, 1986; Wood, Jones & Benjamin, 1986; Richter, 1996; Bodenmann et. al., 1997). In einem von Hejj (1999) durchgeführten Prestigevergleich von 20 Berufen landete der „Psychologe“ auf dem 16. Platz; hinter dem „Psychologen“ firmieren lediglich noch der Schneider, der Metzger, der Verkäufer und der Maurer. Von allen akademischen Berufen schneidet der Psychologe am schlechtesten ab. Gleichzeitig nimmt die Beliebtheit des Studienfaches Psychologie stetig zu (Lüer, 1991). Darüber hinaus sind Psychologen gern gesehen Theorie 26 Gäste in Fernsehshows und werden in Büchern und Filmen nicht selten als humorvoll, einfühlsam und intellektuell beschrieben (Shortland, 1987; Szykiersky, & Raviv, 1995). Die Psychologie wird in der Öffentlichkeit und in den Medien sehr stark über den Bereich der klinischen Psychologie sowie der Psychotherapie definiert. Tabelle2: Medienthema Psychologie (entnommen aus: Perrig-Chiello & Perrig, 1992, S. 6-8) Beziehungsprobleme (Freunde, Partner, Familie) 51% Ängste und Depressionen 37,4% Kommunikationsprobleme 24,5% Aggressives, gewalttätiges Verhalten 18,8% Sexuelle Probleme (einschl. Aids) 18,6% Psychiatrische Erkrankungen 17,4% Suchtprobleme (Alkohol, Drogen, Spielsucht) 12,7% Psychosomatische Beschwerden 10,4% Neurosen 9,6% Stress 8,1% Essstörungen (Magersucht, Bulimie, Fettsucht) 3,0% Behinderungen 3,0% Psychologie wird als eine Wissenschaft bzw. Profession verstanden, die sich mit abweichendem psychischem Verhalten beschäftigt; die Handlungskompetenz des Faches wird darin gesehen, etwaige psychische Probleme mittels professioneller Techniken lösen zu können. Ein Anspruch, den die Psychologie resp. die Profession Psychotherapie bereits von sich aus erhebt (Grawe, Donati & Bernauer, 1999). Perrig-Chiello & Perrig (1992) konnten jedoch zeigen, dass die Psychologie nicht als eigenständige Profession wahrgenommen wird; die Öffentlichkeit unterscheidet nicht trennscharf zwischen verschiedenen Helfer-Berufen. Psychologische Grundlagenfächer sind medial schwer zu vermitteln, wohingegen klinische, forensische und psychotherapeutische Themen die journalistisch relevanten Kriterien der „Betroffenheit“ und „Identifikation“ erfüllen – und somit „leichter“ vermittelbar sind (Sander, 1998; Faust & Hole, 1983). Durch die mediale Verengung des Faches Psychologie auf psychische Störungen (Depression, Spielsucht) bzw. auf psychische Probleme (Eheprobleme, Sexprobleme) wird ein „schiefes“ Bild des Faches erzeugt. Die mediale „Engführung“ ist ein Hinweis darauf, welche Merkmale psychologische Themen aufweisen müssen, um von den Medien aufgegriffen zu werden. Theorie 27 Es liegt im Wesen des Journalismus, dass sich vor allem jene Themen zu behaupten vermögen, bei denen ein direkter Bezug zur Lebenswelt des Rezipienten hergestellt werden kann. Insofern verwundert es nicht, dass Journalisten (auch Wissenschaftsjournalisten) daran interessiert sind, die klinisch-psychotherapeutische Dimension eines Psychologie-Themas heraus arbeiten zu wollen. Es ist davon auszugehen, dass Wissenschaftsjournalisten (als Trainer) während eines Medientrainings von diesen Prinzipien nicht abrücken werden: Ihr Ziel wird es sein, den praktischen Nutzen psychologischer Forschung thematisieren zu wollen. Die konkrete Veränderbarkeit von personalem Verhalten durch Therapie (a), Training (b) oder Beratung bzw. Coaching (c) steht für Wissenschaftsjournalisten im Fokus der Aufmerksamkeit. Aus diesem Grunde müssen PsychologieExperten auch im Rahmen eines Medientrainings (bzw. Interviewtrainings) damit rechnen, dass ihr Thema auf seine „klinische Relevanz“ hin überprüft wird. Auch Psychologinnen und Psychologen, die sich als reine Grundlagenforscher begreifen, werden nicht umhin können, den klinischtherapeutischen Nutzen ihrer Forschung plausibilisieren zu müssen. Journalisten bzw. Wissenschaftsjournalisten entfalten ein Thema entlang jener Kriterien, die im System „Journalismus“ gültig sind und nicht mehr hinterfragt werden (etwa entlang der Kriterien Relevanz, Nähe, Überraschung). Sie sehen ihre Aufgabe darin, ein wissenschaftlich bedeutsames Thema in ein journalistisch bedeutsames Thema zu „transferieren“. Darüber hinaus gehört es zum Selbstverständnis eines (Wissenschafts-)Journalisten, ein spezifisches Thema „kritisch“ zu prüfen. Stellvertretend für das „laienhafte Publikum“ hinterfragt er die Forschungstätigkeit eines Psychologie-Experten. Er begreift sich als „Vertreter“ eines Laien, der sein Recht einfordert, über die Vorgänge innerhalb des Systems „Wissenschaft“ informiert zu werden. Der Journalist ist kein „Sprachrohr“ der Wissenschaft; wenn überhaupt, dann ist er „Sprachrohr“ des Publikums. Dies setzt die Bereitschaft des Journalisten voraus, sich in die „Rolle“ eines Laien bzw. eines laienhaften Publikums hineinzuversetzen und dessen Perspektive zu übernehmen. Der Journalist als „Interessenvertreter“ eines (häufig nicht näher bestimmten bzw. nicht näher bestimmbaren) „LaienPublikums“ konfrontiert den Psychologie-Experten im Rahmen eines Interviews mit gängigen Ansichten (Stereotypien, gängigen Meinungen) bezüglich psychologischer Phänomene bzw. Sachverhalte. Als Stellvertreter des Publikums „aktualisiert“ er Vorbehalte gegenüber der Profession Psychotherapie sowie gegenüber den Klienten psychologischer Dienstleistungen. Anders als etwa die Vertreter einer wissenschaftlich orientierten Psychotherapie annehmen, begegnet die Öffentlichkeit den so genannten „Psycho-Berufen“ (s. Abele, 1990) nach wie vor mit Skepsis; der gelungene Übergang von einer unseriösen Konfession zu einer handlungsmächtigen und allseits akzeptierten Profession wird von der Öffentlichkeit bisher nicht so wahrgenommen (und gewürdigt) wie sich dies Professionsvertreter glauben machen wollen. Der Status der Profession Psychologie bzw. des Berufsfeldes Psychologie kann nicht als gesichert gelten: Die Öffentlichkeit hat nach wie vor ein gespaltenes Verhältnis zur Zunft der Psychologen und zu deren pro- Theorie 28 fessionellen Hilfsangeboten. Journalisten als Vertreter der Öffentlichkeit nehmen diese „Vorbehalte“ auf und konfrontieren Psychologie-Experten mit Fragen nach der Nützlichkeit und Legitimität ihres beruflichen Handelns. Aber nicht nur der Status der Profession bzw. des „Berufes Psychologe“ ist unsicher; auch der Status jener, die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, ist „umstritten“. Aus Sicht der Öffentlichkeit ist der Status psychischer Krankheiten nicht mit dem Status körperlicher Krankheiten gleichzusetzen, auch wenn sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dafür stark macht, psychische und körperliche Krankheiten gleichzustellen. Es ist davon auszugehen, dass Journalisten (auch und gerade in ihrer Funktion als Trainer im Rahmen eines Medientrainings) dazu tendieren werden, den Status psychisch Kranker zu hinterfragen bzw. den „Krankheitswert“ eines psychischen Problems kritisch zu beleuchten. Indem Journalisten den Status psychisch Kranker hinterfragen, zweifeln sie indirekt auch die Legitimität psychologischer „HilfeAnbieter“ an. Der unsichere Status so genannter „Psychologen-Berufe“ und der unsichere Status psychisch leidender Personen bedingen einander. Journalisten als Vertreter (und Bildner) der öffentlichen Meinung thematisieren den Status „psychisch Kranker“ und versuchen eine Klärung des Status´ zu erreichen. Im Zuge eines Medientrainings dürften Journalisten (als Repräsentanten der Laien) besonders dazu angehalten sein, eine solche Rolle – symbolhaft – einzunehmen. Aus Sicht von Journalisten bzw. Wissenschaftsjournalisten zeichnet sich die Wissenschaft Psychologie durch folgende Merkmale aus (Abele, 1990, S. 42-44): • Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Psychologie stehen in Konkurrenz zu dem psychologischen Hausverstand von Laien. • Es existieren mehrere „Psychologien“ bzw. mehrere psychologische Schulen, die divergierende Ansichten und Thesen vertreten. • Die psychologische Fachsprache ist „alltagsnah“ und vermeintlich leicht zu verstehen. • Der „Status“ psychologischer Forschungsberichte ist eher niedrig. • Die Wissenschaft Psychologie verliert sich häufig in unergiebigem „Methodengeklimper“. Das Fach Psychologie als Grenzgänger zwischen Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften verfügt aus Sicht von Wissenschaftsjournalisten nicht über einen gefestigten Status. Zum einen ist das Berufs- und Forschungsfeld des Psychologen nicht klar abgrenzbar bzw. nicht klar abgegrenzt; zum andern wird das Fach üblicherweise als Geistes- bzw. Sozialwissenschaft wahrgenommen und nicht als Naturwissenschaft, weshalb es derselben „kulturelle Geringschätzung“ unterliegt wie andere Sozialwissenschaften auch. Die Gründe für diese Geringschätzung sind nach Peters (1987, S. 29-30) folgende: Theorie • 29 Innerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften gibt es unterschiedliche wissenschaftlichen Paradigmen, die in Konkurrenz zueinander stehen. • Der gesellschaftliche Nutzen der Sozialwissenschaften ist weniger leicht „sichtbar“ zu machen als der Nutzen der Natur- und Ingenieurswissenschaften. • Sozial- und Geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse sind einem Trivialitätsverdacht ausgesetzt: Die von diesen Disziplinen gewonnen Erkenntnisse gelten häufig als selbsterklärend und evident. • Aufwand und Ertrag stehen in einem Missverhältnis. Der methodische und forscherische Einsatz führt nicht zu einem adäquaten „Mehrwert“. • Der Fortschritt auf dem Gebiet der Sozial- und Geisteswissenschaftler vollzieht sich langsamer als auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Sozial- und geisteswissenschaftliche Themen erfüllen deshalb häufig nicht den journalistischen Nachrichtenwert der „Aktualität“. Abbildung 3: Medienpräsenz von Sozial- und Naturwissenschaften im Ressort Wissenschaft (entnommen aus: Böhme-Dürr & Grube, 1989, S.451) 100 80 60 40 20 0 "Der Spiegel" "stern" Sozialwissenschaften "Die Zeit" "Rheinscher Merkur" Naturwissenschaften Der Status psychologischer Themen ist aus Sicht der Medien nicht besonders hoch. Psychologie gilt als Wissenschaft, die viele Theorien hervorbringt, aber wenig verlässliche Erkenntnisse. Ferner werden psychologische Forschungsergebnisse in der Regel nicht in den großen Fachzeitschriften wie Science oder Nature publiziert, aus denen Wissenschaftsjournalisten bzw. Wissenschaftsredaktionen ihre Themen gewinnen. So erklärt sich, weshalb psychologische Themen zwar stark in den Medien vertreten sind, aber nur selten unter einem dezidiert wissenschaftsjournalistischen Blickwinkel rezipiert werden. Theorie 30 Ob man einen solchen Umstand beklagt, hängt davon ab, ob man der Meinung anhängt, Wissenschaft müsse sich ausschließlich im Ressort Wissenschaft abspielen oder ob man glaubt, Wissenschaft habe mehrere „journalistische Orte“ (etwa im Vermischten, im Ressort Politik oder Gesellschaft). Die Wissenschaft „Psychologie“ wird von den Medien als „weiche“ Wissenschaft wahrgenommen. Die von Psychologen behaupteten Zusammenhänge gelten als strittig; die wissenschaftliche These fußt stets auf einem mit Unsicherheit belasteten induktiven Argumentationsschluss; die Schlussregel, mit der sich eine These stützen ließe, ist zumeist nicht unumstritten. An die Stelle abstrakt dargelegter „Schlussregeln“ treten in der Psychologie deshalb häufig Beispiele oder Fallgeschichten, Metaphern oder Analogien. Auf diese Weise soll es gelingen, einen mehr oder weniger wahrscheinlichen Zusammenhang als zwingend erscheinen zu lassen. Durch eine stark erfahrungsbasierte oder „kasuistische“ Argumentationsführung verwischt jedoch die Grenze zwischen „Praxis“ und „Theorie“, wodurch eine Konfundierung verschiedener Rollen (Wissenschaftler vs. Berufspraktiker) auf Seiten des medial agierenden Psychologen präjudiziert ist. Aus den o. g. Gründen ist es schwer, wissenschaftliche Themen mediengerecht zu vermitteln. Bei der Vermittlung psychologischer Wissenschaftsthemen stellen sich neben den wissenschaftsspezifischen Vermittlungsproblemen (s. Tabelle 3) auch psychologie-spezifische Vermittlungsprobleme (s. hierzu etwa Rietz & Wahl, 1997). Tabelle 4: „Schwierigkeiten“ bei der Vermittlung eines psychologischen Themas [Psychologie-spezifische Vermittlungsproblematik] 1. Journalisten „verkürzen“ psychologische Themen auf den therapeutisch-klinischen Aspekt. Psychologie-Experten sind nicht darauf vorbereitet, ihr Wissensthema aus einem solchen Blickwinkel heraus deuten zu müssen. 2. Journalisten hinterfragen den Machtanspruch, den die Profession Psychologie bzw. Psychotherapie erhebt. Psychologie-Experten erklären das „Wie“ ihres professionellen Handelns nicht überzeugend genug. Dadurch erweist sich der Machtanspruch der Profession als nicht ausreichend begründet. 3. Journalisten treten mit ihren eigenen subjektiven Theorien und Interpretationen in Konkurrenz zu Psychologen. Psychologie-Experten fällt es schwer, diese laienhaften Deutungen zu entkräften [Fehlende Interpretationshoheit]. 4. Journalisten konfrontieren Psychologen mit der Frage nach der Nützlichkeit ihrer Forschung. Psychologen gelingt es nicht immer, die Legitimität ihres wissenschaftlichen Handelns zu rechtfertigen [Legitimationsproblem]. 5. Journalisten aktivieren „Vorurteile“ gegenüber psychisch kranken Personen. Psychologie-Experten müssen einen hohen verbalen Aufwand betreiben, um solche Stereotypien zu entkräften. 6. Journalisten wünschen sich von Psychologen krankheits- spezifische Fallschilderungen. Psychologen können diesem Wunsch nicht immer entsprechen. Theorie 31 2.2 Laiengerechte Vermittlung psychologischer Themen Die Kommunikation zwischen Wissenschaftsjournalist und Psychologie-Experte im Rahmen eines „simulierten“ Fernsehinterviews kann als Sonderfall der Experten-Laien-Kommunikation begriffen werden. Die zwei Voraussetzungen, die es gestatten, von einer solchen Kommunikationsform zu sprechen, sind erfüllt: a. Es existiert ein systematischer Wissensunterschied zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern. b. Die Gesprächsteilnehmer sind sich dieser „Wissenskluft“ bewusst. So wie jede andere Form der Experten-Laien-Kommunikation wird auch das Interview zwischen Journalist und Wissenschaftler in der Absicht geführt, die Wissensbestände des Experten verständlich und transparent zu machen. Es handelt sich folglich um den Versuch, eine unbestreitbare Wissenskluft zumindest im Ansatz zu überwinden. Allerdings ist eine Kommunikation zwischen Laie und Experte nicht primär darauf ausgerichtet, Wissen auf nachvollziehbare Weise zu vermitteln; es ist kein pädagogischer Impetus, der die Kommunikation zwischen Laie und Experte prägt. Vielmehr geht es darum, den Laien durch „Wissensteilhabe“ in die Lage zu versetzen, eigene Handlungen und Entscheidungen zu planen bzw. theoretisch planen zu können. Ein Arzt etwa, der über die Gefahren einer Operation aufklärt, verfolgt keinesfalls das Ziel, einen Patienten (Laien) zu „belehren“; ihm geht es darum, seine Wissensbestände „laiengerecht“ auszubreiten, um auf diese Weise einen Teil seiner Entscheidungs- und Handlungsmacht an den Laien abtreten zu können. Gleiches gilt für den Psychologie-Experten im Fernseh- oder Hörfunkinterview: Wenn ein solcher Experte z. B. über eine psychische Störung gemäß ICD-10 aufklärt, so geschieht dies mit dem Ziel, den Laien zu selbständigen Entscheidungen zu befähigen bzw. die Einstellungen des Laien bezüglich eines bestimmten Störungsbildes zu beeinflussen. Folgenden Zielen dient die ExpertenLaien-Kommunikation: 1. Wissensvermittlung 2. Aufklärung 3. Änderung von Einstellung 4. Erteilen von Entscheidungshilfen Drei Fragen stehen bei der Erforschung von Kommunikationsvorgängen zwischen Experten und Laien im Vordergrund: Theorie 32 1. Wie gehen Experten mit bestehenden Wissensunterschieden um? 2. Wie kann Kommunikation unter ungleichen Voraussetzungen gelingen? 3. Wie lässt sich die Kommunikation zwischen Experten und Laien verbessern? Psychologinnen und Psychologen überschätzen die „Verständlichkeit“ der vielen vermeintlich selbsterklärenden Begriffe ihres Faches; sie schätzen die Verbreitung ihres fachsprachlichen Wissens unrealistisch hoch ein. Ein Phänomen, das in der Psychologie als False- Consensus-Effekt bekannt ist. Das False- Consensus- Phänomen beschreibt die Tatsache, dass Personen dazu neigen, die eigenen Überzeugungen und Einstellungen für verbreiteter zu halten als sie eigentlich sind. Gemäß der False- Consensus- Hypothese müsste z.B. ein Raucher die Zahler der Raucher in der Bundesrepublik überschätzen. Diese Fehleinschätzung führen Ross, Greene & House (1977), die Begründer des Konzeptes, auf eine egozentristisch orientierte Wirklichkeitswahrnehmung zurück. Nach Ross et al. ist unter bestimmten Umständen auch ein Fehlschluss in die andere Richtung denkbar (Unterschätzen der eigenen Einstellungen). In der Experten-Laien-Kommunikation wird der False- Consensus-Effekt im Hinblick auf Wissensbestände und deren vermeintlich Verbreitung untersucht. Nickerson et al. (1987) konnten den False- Consensus- Effekt im Zusammenhang mit „Wissensfragen“ nachweisen: Die Forscher ließen Versuchspersonen sowohl verschiedene Wissensaufgaben beantworten als auch diese Aufgaben von jedem der teilnehmenden Probanden danach beurteilen, für wie wahrscheinlich sie es erachten, dass die anderen Studienteilnehmer die jeweilige Frage zu beantworten vermögen. Dabei zeigte sich: Bei jenen Fragen, die ein Proband zu beantworten imstande war, schätzte er die Wahrscheinlichkeit, dass andere Probanden diese Frage gleichfalls richtig beantworten würden, höher ein als bei Fragen, auf die er selbst keine Antwort wusste. In einem zweiten Schritt verglichen Nickerson et al. diese „Schätzungen“ mit der tatsächlichen Wissensverbreitung in der Population und stellten fest: Ist jemand im Besitz von Wissen hinsichtlich eines bestimmten Gegenstandes, so zieht er daraus fälschlicherweise den Schluss, dass auch andere Personen im Besitz dieses Wissens sein müssen. Psychologie-Experten, so eine Quintessenz, die sich aus Nickersons Experiment ziehen lässt, drücken sich also nicht willentlich unverständlich aus. Es ist weder Ausdruck von Arroganz noch von Inkompetenz, wenn Experten, ganz ihrem „Fachchinesisch“ verpflichtet, über den „Kopf von Laien hinweg“ reden. Vielmehr ist dieser Umstand darauf zurück zu führen, dass Experten im Zuge ihrer Berufsausübung21 der laienhafte Blick verloren geht; sie können nicht mehr so ohne weiteres von ihrer eigenen Perspektive abstrahieren. Experten und Laien unterscheiden hinsichtlich der folgenden Merkmale voneinander: 21 Die Entwicklungspsychologie bezeichnet diesen Vorgang als Enkulturation. Theorie 33 1. Fachsprache 2. Fachkonzepte 3. Kategoriale Wahrnehmung 4. Einstellungen und Überzeugungen 5. Konventionen Tabelle 5: Perspektivendiskrepanzen auf dem Expertisefeld „Schizophrenie“ Dimension Experten-Sicht Laien-Sicht Fachausdruck Der Experte verwendet bestimmte Fachausdrücke wie „Psychose“ oder „Gedankeneingebung“ selbstverständlich, ohne sie genauer zu erklären. Der Laie hat nur eine vage Vorstellung davon, was mit „Psychose“ oder „Gedankeneingebung“ gemeint ist Fachkonzept Der Experte weiß, welche Symptome eindeutig für eine Schizophrenie sprechen und welche nicht; er legt dieses Wissen jedoch nicht offen. Der Laie weiß nicht, welche Symptome konstitutiv für die Störung „Schizophrenie“ sind und welche nicht. Kategoriale Wahrnehmung Der Experte grenzt Störungsbilder kategorial voneinander ab; für ihn sind affektive und psychotische Störungen unterschiedliche Kategorien. Der Laie kennt keine schizophrenen Patienten; ihm fehlt die personenbezogene Anschauung, um zwischen verschiedenen Störungsklassen zu unterscheiden. Einstellung / Überzeugung Der Experte ist davon überzeugt, dass schizophrene Patienten effektiv behandelt werden können (a) und dass schizophrene Patienten nicht gefährlich sind (b). Diese Überzeugungen legt er nicht eigens dar. Der Laie hat eine stereotype Vorstellung vom Schizophrenie-Patienten; er hält ihn u. U. für gefährlich und behandlungsresistent. Konvention Der Experte weiß, dass gemäß ICD-10 eine bestimmte Anzahl an Symptomen vorliegen muss, um die Diagnose Schizophrenie stellen zu dürfen. Er stellt die Gültigkeit dieser „Konvention“ nicht in Frage. Der Laie begreift nicht, wovon es abhängt, ob ein Verhalten als normal oder „pathologisch“ eingestuft wird. Ihm sind die fachinternen Konventionen nicht vertraut. Theorie 34 Am Beispiel des Expertisefeldes „Schizophrenie“ lässt sich verdeutlichen, worin sich die Laienund die Experten-Sicht unterscheiden und wie es dadurch zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen kann. Wie andere psychische Störungen auch ist „Schizophrenie“ ein beliebtes Medienthema (s. Bild der Wissenschaft, Ausgabe 12, 2004). Wer über dieses Thema als Experte spricht, der muss damit rechnen, dass der Laie nicht nur weniger über „Schizophrenie“ weiß, sondern auch über andere Einstellungen und Überzeugungen hinsichtlich schizophrener Patienten bzw. hinsichtlich der Behandelbarkeit schizophrener Patienten verfügt. Indem der Experte sein Wissen (bezüglich bestimmter Fachausdrücke, Konzepte oder Einstellungen) nur unzureichend expliziert, kommt es zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Laie und Experte. Nach Bromme (2000) setzt der Experte implizit Wissen voraus, das er jedoch erst entfalten müsste, um vom Laien verstanden zu werden. Die fehlende Bereitschaft bzw. Fähigkeit, Wissensbestände zu offen zu legen, bedingt ursächlich das „kommunikative Problem“, vor das Experten und Laien gestellt sind, wenn sie miteinander in Interaktion treten. Auf allen o. g. Dimensionen (Fachkonzept, Überzeugung, Konvention) mangelt es dem Laien an Kenntnissen, weshalb es nicht ausreicht, lediglich Fachausdrücke zu „übersetzen“; darüber hinaus ist es auch nötig, jenes Wissen offen zu legen, das die Grundlage für bestimmte Überzeugungen und Konventionen darstellt. In der Forschung zur Experten- Laien- Kommunikation (Jucks, 2001) wird davon ausgegangen, dass ein Gelingen bzw. Misslingen von Kommunikation unter der Bedingung ungleich verteilten Wissens maßgeblich davon abhängt, ob es dem Experten gelingt, die Perspektive des Laien zu „übernehmen“. Das Konstrukt der „Perspektivenübernahme“ ist deshalb von zentraler Bedeutung in diesem Forschungsfeld (s. hierzu Gruber & Ziegler, 1996). Bei der „Perspektivenübernahme“ handelt es sich um ein allgemeines psychologisches Konstrukt, das in verschiedenen Teildisziplinen der Psychologie erforscht wird. Die Fähigkeit, die Perspektive eines Anderen zu übernehmen, d.h. sich in seine „Wahrnehmungssituation“ hinein zu versetzen, bildet sich erst im Laufe der ontogenetischen Entwicklung aus (Piaget, 1975). In Experimenten mit so genannten „verkürzten Bildergeschichten“ konnte gezeigt werden, dass es Kindern erst ab einem bestimmten Alter gelingt, sich in die Rolle eines anderen „hinein zu denken“. Historisch gesehen, ist das Konstrukt der „Perspektiven- bzw. Rollenübernahme“ in der Entwicklungspsychologie angesiedelt (Flavell, 1992). Mittlerweile wird es jedoch auch in anderen Wissenschaftszweigen erforscht, etwa in der Psycholinguistik. In diesem Forschungsfeld wird die automatische Regulation des eigenen Sprachniveaus an das Sprachniveaus eines Anderen als Indiz für eine gelungen Perspektivenübernahme gewertet (Krauss & Fussell, 1991). Ziel der Forschung in den einzelnen Teildisziplinen ist es, die Bedingungen zu spezifizieren, unter denen die Übernahme einer Perspektive gelingt bzw. fehlschlägt. Hierbei scheint es besonders schwierig zu sein, zwischen motivationalen, kognitiven und situativen Faktoren zu trennen. Die Tatsache, dass jede Person von ihrem kognitiven Vermögen her im Stande ist, die Perspektive Theorie 35 eines Anderen zu übernehmen, lässt den Mangel an vollzogener Perspektivenübernahme auch als Motivationsproblem sichtbar werden. Bezogen auf die Experten-Laien-Kommunikation spielen die motivationalen Voraussetzungen der Kommunikation eine große Bedeutung: Wie Studien gezeigt haben, hängt der Grad der verwirklichten Perspektivenübernahme (Antizipationsleistung) davon ab, in welchem Maße einem Experten überhaupt bewusst ist, dass er die Laienperspektive übernehmen sollte (Nückles & Bromme, 1998). Experten, so die Erkenntnis, fehlt häufig die Einsicht in die Exklusivität ihres Wissens; sie sind sich ihrer eigenen superioren Rolle nicht ausreichend bewusst. Eine realistische Abschätzung des Laienwissens und der damit verbundenen Laienperspektive ist jedoch trainierbar, wie Nückles (2000) zeigen konnte. Im Falle einer Kommunikation zwischen Experte (Psychologe) und Journalist (Repräsentant des Laien) dürfen die motivationalen Einflussfaktoren nicht unterschätzt werden. Die Bereitschaft zur Perspektivenübernahme ist immer auch ein Indikator für Kooperativität; nur wer in einem Gespräch kooperieren will, wer also tatsächlich die Absicht verfolgt, sein eigenes Wissen transparent zu machen, der ist auch willens, die Rolle des Laien gedanklich durchzuspielen. Die Kommunikation zwischen Experte und Laie kann jedoch auch dazu dienen, den eigenen Experten-Status zu verteidigen oder das eigene Expertentum offensiv nach außen zu demonstrieren (s. hierzu die Selbstdarstellungstechniken nach Mummendey, 1985). Es wäre „naiv“, wenn man pauschal unterstellen würde, dass jede Experten-Laien-Kommunikation lediglich darauf ausgerichtet wäre, Wissen zu popularisieren; Experten können eine Kommunikation auch aus ganz anderen Motiven führen, ohne dass sich diese Motive aus dem Inhalt des Gesagten so ohne weiteres „heraus lesen“ ließen. Bei der Kommunikation zwischen Journalist und Experte wird die „Kooperationsbereitschaft“ des Experten ohnehin auf eine „harte Probe“ gestellt; der Journalist nämlich kann sachlich oder kritisch fragen, wodurch er aus Sicht des Experten nicht nur die Übernahme einer Laienperspektive einfordert, sondern zugleich den Experten-Status (mehr oder weniger deutlich) in Frage stellt. Die Verweigerung des interviewten Experten (Psychologen), die Perspektive des Laien zu übernehmen (und damit von der eigenen Expertenperspektive) abzurücken, kann somit auch das Ergebnis eines interaktionalen Prozesse sein. „Ausbildung und Erfahrung“, schreibt Bromme et. al. (2003, S. 23) „bewirken, dass man die Dinge, die für die Berufstätigkeit wichtig sind, eben auf eine bestimmte Weise sieht. Dann ist es schwierig, sich vorzustellen, wie man diese Dinge (ein Röntgenbild, einen Gebäudeentwurf, die Benutzeroberfläche eines Computers) sähe, wenn man nicht über den fachlichen Blick des Arztes, des Architekten oder des EDV-Fachmanns verfügen würde.“ Die Genauigkeit (Veridikalität), mit der Psychologie-Experten das Wissen eines laienhaften Anderen abzuschätzen vermögen, ist gering22. Der irrigen Überzeugung anhängend, der Laie verstehe mehr von Psychologie als dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich das Ziel ihrer nach außen gerichte22 Ein Schicksal, das Psychologen zum Beispiel mit Architekten teilen (Rambow, 2003) Theorie 36 ten Kommunikation, nämlich Verständigung mit der breiten Öffentlichkeit herzustellen, nicht mehr einlösen: Die Kommunikation schlägt fehl. Solange Psychologen nicht wissen, was der Laie tatsächlich weiß, kann ihr Versuch kaum glücken, die Wissensbestände des eigenen Faches verständlich zu machen. Die Studien von Nickerson, Baddeley & Freeman (1987) zeigen ebenso wie die Untersuchungen von Fussell & Kraus (1992), dass die Kommunikation zwischen Experte und Laie nur dann gelingen kann, wenn der Experte das Wissen des Laien annähernd richtig einschätzt. Im Rahmen eines Medientrainings für Psychologie-Experten ist es deshalb notwendig, einen „Aufforderungscharakter“ zu schaffen, der Psychologie-Experten dazu veranlasst, sich des eigenen Expertentums bewusst zu werden und sich zugleich den Laienstatus des Interviewpartner zu vergegenwärtigen (zu diesem Problem, s. Unterkapitel 7.6.2.). Der Psychologie- Experte verfügt über privilegierte Informationen, die er im Rahmen des Interviews preiszugeben bereit ist. In der Experten-Laien-Kommunikation wird vom „Paradigma der privilegierten Information“ ausgegangen (Flavell, 1992). Flavells Paradigma kann als kognitionspsychologische Weiterentwicklung des Konstruktes der „Perspektivenübernahme“ angesehen werden. Die laiengerechte Vermittlung psychologischer Wissensthemen im Rahmen eines Fernsehinterviews setzt die Bereitschaft des Psychologen voraus, das Privileg psychologisches Fachwissens mit einem laienhaften Publikum teilen zu wollen, wobei dieses Publikum durch den Journalisten symbolhaft repräsentiert wird. Wissenschaftskommunikation im medialen Kontext ist folglich, etwas idealisierend formuliert, die Grundlage für eine Teilhabe am macht- und status- sichernden Privileg „psychologisches Wissen“. Indem der Psychologie- Experte sein fachbezogenes Wissen offen legt und verständlich zu machen versucht, räumt er dem Journalisten selbsttätig und freiwillig die Möglichkeit ein, dieses Wissen kritisch zu hinterfragen. Dadurch verliert das Fachwissen faktisch an Exklusivität. Bei strenger Betrachtung erweist sich diese Freiwilligkeit nur als eine relative, schließlich ist der Wissenschaftler gezwungen, seine Forschung öffentlich kenntlich zu machen, um finanzielle Ressourcen für seine Vorhaben einzutreiben. Das Öffentlich-Machen des eigenen Forscherhandelns ist eine folgenreiche Handlung: Erst durch diese Handlung löst der Wissenschaftler seine Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit ein. Die überwältigende Mehrzahl der Wissenschaftler sieht es als ihr berufliche Pflicht an, die Öffentlichkeit über das eigene Forschungshandeln zu informieren. Ob sich dahinter ein gewandeltes – demokratisiertes – Selbstverständnis verbirgt oder die instrumentell ausgerichtete Erkenntnis, dass die Öffentlichkeit als „Vehikel“ zur Durchsetzung eigener Ziele taugt, lässt sich an dieser Stelle nicht entscheiden. Vom logischen Standpunkt aus betrachtet, müssen die beiden Motive nicht notwendigerweise im Widerspruch zueinander stehen, schließlich ist es möglich, eine Handlung als „nützliche“ Pflicht zu begreifen. Die wissenschaftlichen Inhalte und Forschungsabsichten darlegend, schafft der Wissenschaftler bzw. der Psychologie-Experte aus sich heraus die Voraussetzung dafür, dass eine kritische Hinter- Theorie 37 fragung dieser Wissensinhalte sowie dieser Handlungsabsichten möglich wird. Im geschlossenen Raum der Wissenschaft ist die Frage nach der Nützlichkeit (resp. der gesellschaftlichen Verwertbarkeit) der Forschung ebenso sekundär wie die Frage nach der ethisch-moralischen Legitimität: Das eigene Tun ist aus sich heraus begründet bzw. es gelten andere Nützlichkeitskriterien. Die kommunikativen Prämissen, die im binnenwissenschaftlichen Kontext gültig sind, werden in jenem Moment außer Kraft gesetzt, in dem der Wissenschaftler sich und seine Forschung in einen außerwissenschaftlichen Kontext rückt. Wie auch immer dieses Öffentlich-Machen subjektiv motiviert sein mag, es ist – formal betrachtet – ein Ausdruck von Kooperativität (Grice, 1975). Bereits das bloße Sich- Einlassen auf einen Diskurs im öffentlichen Raum kann als Zeichen der Kooperativität gewertet werden. Für die Dauer eines Fernsehinterviews rückt der Wissenschaftler von seinem unhinterfragbaren Status ab und lässt sich auf einen Diskurs der Problemlösung ein, der sich zwischen gleichberechtigten Partner abspielt. Das heißt aber nichts anderes als dass der Experten-Status im Gespräch erarbeitet oder – im Ernstfall – sogar erstritten werden muss. Für das Gelingen dieser öffentlichen Kommunikation gibt es keine Gewähr. Aus Sicht des Wissenschaftlers ist die Kommunikation mit einem laienhaften Publikum ein Wagnis. Zugespitzt formuliert: Die öffentliche Demontage eines Wissenschaftlers ist nur möglich, wenn der Wissenschaftler zuvor in diese Demontage eingewilligt hat. Indem der Wissenschaftler sich bereit erklärt, die eigene Forschung laiengerecht darzulegen, willigt er zugleich auch in eine mögliche Zurückweisung seiner Forschungstätigkeit durch die Öffentlichkeit ein. Die Kommunikation zwischen Experte und Journalist ist somit ein Sonderfall der Experten-Laien-Kommunikation, weil der Journalist vom Psychologie-Experten verlangt, sich an die Perspektive des Laien sprachlich und argumentativ zu adaptieren (1) und weil er den Experten darauf verpflichtet, seinen Experten-Status inhaltlich zu legitimieren (2). Die Kommunikation zwischen Experte und Laie im Rahmen eines (Fernseh-)Interviews fußt keinesfalls auf jener Art von Verhältnis, das Lehrer und Schüler miteinander unterhalten. Es leuchtet unmittelbar ein, dass auch die Beziehung zwischen Wissenschaftsjournalist und Experte nichts mit einem solchen Lehrer-Schüler-Verhältnis gemein hat. Der systematische Wissensunterschied sichert dem Experten nicht automatisch die handlungsmächtigere Position. Im Gegenteil, die „Regeln“ des Gespräches werden vom Journalisten vorgegeben, ihm fällt die Aufgabe zu, das Gespräch zu leiten und zu strukturieren: Theorie 38 1. Der Journalist repräsentiert symbolhaft die Position des Laien (Stellvertreterfunktion). 2. Der Journalist „entscheidet“ darüber, ob der Versuch einer laiengerechten Vermittlung geglückt ist oder nicht; durch Nachfragen verlangt er dem Experten ein höheres Maß an Laienorientierung ab. 3. Der Journalist ist vom Laien unterschiedlich weit entfernt. Den Grad an Laienorientierung, den der Journalist (durch Nachfragen) einfordert, ist evtl. von seinem eigenen Status abhängig. Ist der Journalist selbst Laie auf einem Feld, so ist die Journalistenperspektive nahezu mit der Laienperspektive identisch; ist der Journalist jedoch seinerseits eine Art Experte, so fallen Laien- und Journalistenperspektive möglicherweise auseinander. Je weniger sich ein Journalist tatsächlich als Repräsentant des Laien begreift (bzw. als ein solcher vom Experten wahrgenommen wird), desto eher dürfte er bereit sein, eine Expertenäußerung als laiengerecht zu bewerten und somit auf eine weitere Nachfrage (bzw. Präzisierung) zu verzichten. Es handelt sich folglich um ein Prinzip der doppelten Laienorientierung: Der Experte ist gehalten, sich an den Journalisten (als Laienrepräsentant) zu adaptieren und der Journalist ist aufgefordert, aus der Sicht seines laienhaften Publikums zu sprechen. Im Grunde werden vom Experten zwei Orientierungen eingefordert, die nicht notwendigerweise identisch sein müssen: Er muss sowohl die Perspektive des Journalisten als auch die Perspektiven des tatsächlichen Laien, also des Publikums, einnehmen. Anders als bei der „klassischen“ Experten-Laien-Kommunikation gründet das Interview zwischen Journalist und Wissenschaftler auf einer Paradoxie: Obgleich der Experte über einen systematischen Wissensvorsprung verfügt, ist er, strukturell gesehen, in der schwächeren Position. Denn der Experte ist es, der sich erklären und gegebenenfalls rechtfertigen muss. In der Bereitschaft, das eigene Wissen öffentlich zu popularisieren, ist die Gefahr angelegt, für dieses „Wissen“ bzw. für die sich daraus ergebenden Konsequenzen haftbar gemacht zu werden. Das kommunikative Risiko des Experten ist folglich höher als das Risiko für den interviewenden Wissenschaftsjournalisten. Die Kommunikation zwischen Journalist (als Laien-Vertreter) und Experte (Psychologie-Experte) unterscheidet sich in einigen Punkten von der „klassischen“ Experten- Laien- Kommunikation. In der nachfolgenden Abbildung wird versucht, die Unterschiede zu systematisieren. Theorie 39 Tabelle 6: Unterschiede zwischen Experten-Laien-Kommunikation im medialen und im nicht-medialen Kontext „Klassische“ Experten-LaienKommunikation Experten-Laien-Kommunikation im medialen Kontext Durch den Wissensvorsprung sichert sich der Experte die verbale Handlungsmacht während des Gespräches Die verbale Handlungsmacht des Experten ist während des Interviews nicht gesichert – trotz des Wissensvorsprungs, über den der Experte verfügt Der betreffende Sachverhalt muss entfaltet und bewertet werden, wobei der Bewertung des Sachverhaltes keine besondere Bedeutung zukommt Der betreffende Sachverhalt muss entfaltet und bewertet werden, wobei der Bewertung des Sachverhaltes eine besondere Bedeutung zukommt Der Laie wird direkt angesprochen und nicht durch einen „Dritten“ repräsentiert Der Laie wird symbolhaft durch den Journalisten repräsentiert und ist nur „virtuell“ anwesend bzw. muss imaginiert werden Das verwirklichte Ausmaß an Laienorientierung wird ausschließlich vom Experten bestimmt Das verwirklichte Ausmaß an Laienorientierung wird durch die Fragetechnik des Journalisten evtl. mitbedingt Der Experte ist aufgefordert, ausschließlich die Perspektive des Laien zu antizipieren; die ZielPerspektive ist eindeutig Der Experte ist aufgefordert, sowohl die Laienals auch die Journalistenperspektive zu antizipieren; diese beiden Perspektiven sind nicht notwendigerweise deckungsgleich Die Laienorientierung ist das Ergebnis eines Monologes; der Experte ist dafür verantwortlich dafür, welches Ausmaß an Laienorientierung verwirklicht wird Die Laienorientierung ist das Produkt einer Interaktion; der Interviewer ist mitverantwortlich dafür, welches Ausmaß an Laienorientierung verwirklicht wird Zur Experten-Laienkommunikation gehört zweierlei: Die verständliche und anschauliche – eben laiengerechte – Vermittlung eines wissenschaftlichen Tatbestandes und die (möglichst handlungsrelevante) Bewertung dieses dargelegten Tatbestandes. Wie aus dem Kategoriensystem von Rambow (2003, S. 231) hervor geht, lassen sich sowohl inhaltsspezifische (Fachkonzept, Bewertung, Potential) als auch inhaltsunspezifische Indikatoren (Einbezug, Metakommunikation) der Laienorientierung unterscheiden (genaueres hierzu in Kapitel 6). Theorie 40 2.3. Experten-Laien-Kommunikation im medialen Kontext Durch den medialen Kontext, in dem sich die Experten-Laien-Kommunikation vollzieht, ist der Psychologie-Experte vor ein besonderes „Kommunikationsproblem“ gestellt: Zum einen muss er seine Inhalte so vermitteln, dass sie von einem (nicht näher bekannten) Laienpublikum verstanden werden; zum andern muss er sich an die Perspektive des Journalisten adaptieren, der seinerseits die Perspektive des Laien zu antizipieren versucht. Zwar tritt der Journalist in einem Fernsehinterview als „Stellvertreter“ bzw. „Fürsprecher“ des Laien auf; gleichzeitig ist er jedoch angehalten, seinen „journalistischen Auftrag“ einzulösen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, zwischen zwei „Orientierungen“ zu unterscheiden: 1. Allgemeine Laienorientierung im Sinne einer Hinwendung zum Laien bzw. zum Laienpublikum, an den sich das Interview richtet. 2. Spezifische Laienorientierung (resp. Medienorientierung) im Sinne einer Hinwendung zum Journalisten, der den Laien repräsentiert und der dessen Anspruch auf Informiertheit einlöst. Laienorientierung wird in dieser Arbeit als spezifische Laienorientierung begriffen. Um zu beurteilen, ob sich ein interviewter Experte auf die „Perspektive“ des Journalisten einlässt, ist zweierlei nötig: Zunächst müssen die kommunikativen Anforderungen spezifiziert werden, die sich aus dem medialen Kommunikationsumfeld ergeben, d. h. es müssen die Erwartungen benannt werden, die ein Journalist an einen Experten stellt (ideales Interviewverhalten eines Experten aus Sicht des Journalisten); darüber hinaus muss bestimmt werden, welche Verbalhandlungen während des konkreten Vollzuges eines Interviews als „Indikatoren“ für eine Hinwendung zum Journalisten bzw. zum Gesprächspartner angesehen werden können. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, inwiefern sich der Grad der „Aktualisierung“ des medialen Kontextes auf die Bereitschaft des Experten auswirkt, die Laien- bzw. Journalistenperspektive zu antizipieren oder nicht. Je stärker der Journalist darauf abzielt, eine dezidiert journalistische Kommunikation zu verwirklichen, desto wahrnehmbarer werden die sich aus dem medialen Kontext ergebenden Anforderungen: Durch kritisches Hinterfragen eines Sachverhaltes oder durch die Aufforderung, das Gesagte zu „kondensieren“, wird die mediale Situation, in der sich das Interview vollzieht, vergegenwärtigt. Indem der Journalist als Repräsentant des Laien seine Fragen sowohl in einem wohlwollend-sachlichen als auch in einem kritisch- hinterfragenden Duktus vorbringen kann, „provoziert“ er eine bestimmte Orientierung; das gezeigte Verbalverhalten seitens des Experten ist folglich das Ergebnis eines interaktionalen Prozesses. Der Journalist kann sich unterschiedlicher Frage-Techniken (bzw. Frage-Stile) bedienen, wobei Kognitionsfragen bzw. kritische Fragen (im Sinne Hallers, 1991) direkt oder indirekt darauf abzielen, den Status des Experten zu hinterfragen. Theorie 41 Mittels solcher Frage-Typen zwingt der Journalist den Experten dazu, seinen Experten-Status zu verteidigen und damit die wissenschaftlichen Inhalte, die diesen Status begründen, zu rechtfertigen. Die Art der Explikation eines wissenschaftlichen (psychologischen) Sachverhaltes ist vom Frage-Modus abhängig, den der Journalist wählt. Die Explikation eines wissenschaftlichen Sachverhaltes kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen: 1. Explizite Erläuterung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes 2. Explizite Verteidigung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Bei einer erläuternden Explikation eines wissenschaftlichen Tatbestandes ist der Experte in einer offensiven (oder zumindest neutralen) kommunikativen Position, d. h. er kann seine wissenschaftliche These ausbreiten, die Originalität seiner Forschung herausstellen und seine fachliche Kompetenz demonstrieren; bei einer verteidigenden (apologetischen) Explikation eines wissenschaftlichen Sachverhaltes ist der Experte in einer defensiven kommunikativen Position, d.h. er muss die Stimmigkeit einer behaupteten These begründen, die (möglicherweise in Zweifel gezogene) Originalität seiner Forschung belegen und seine fachliche Kompetenz beweisen. Die Notwendigkeit, einen wissenschaftlichen Sachverhalt zu verteidigen, erstreckt sich auf alle potentiell explizierbaren Teilaspekte dieses Sachverhaltes (Fachkonzept, These, Klient, etc.). Tabelle 7: Explizite Erläuterung bzw. Verteidigung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Fachbegriff Fachkonzept bzw. Konstrukt Wissenschaftliche These bzw. Spitzenformulierung Innerpsychischer Prozess Techniken der Profession Klienten Explizite Erläuterung vs. Verteidigung eines in der psychologischen Forschung relevanten Terminus Explizite Erläuterung vs. Verteidigung eines psychologisch fundierten Konzeptes bzw. Konstruktes Explizite Erläuterung vs. Verteidigung einer auf empirischen Daten fußenden wissenschaftlichen These, die argumentativ begründet wird Explizite Erläuterung vs. Verteidigung der Gründe, weshalb sich eine Person psychisch verändert oder entwickelt hat Explizite Erläuterung vs. Verteidigung der berufsspezifischen Techniken, mit denen im Rahmen einer Therapie, eines Coaching oder eines Trainings interveniert wird Explizite Erläuterung vs. Verteidigung des Krankheitswertes einer psychischen Störung“ bzw. der Behandlungsbedürftigkeit eines Klienten psychologischer Hilfeangebote Aus Sicht des Experten kommt es durch einen Wechsel des Fragetyps (Sachfrage vs. kritische Frage) zu einer „Verschiebung“ der funktionalen Bedeutung des Interviews, wie die nachfolgende Abbildung illustriert: Theorie 42 Tabelle 8: Interview-Ziel und -Anforderung aus Sicht des Experten Fragemodus Sachfragen Verständnisfragen Kognitionsfragen Interpretationsfragen Interview-Anforderung Orientierung ist auf den Laien gerichtet (fremdgerichtete Orientierung) Orientierung ist auf den Laien und auf die eigene Person (selbst- und fremdgerichtete Orientierung) Interview-Ziel Demonstration des eigenen Status Sicherung resp. Verteidigung des eigenen Status Nach Haller (1991, S. 222ff.) lassen sich verschiedene Frageformen unterscheiden. Er gibt einen umfassenden Überblick über verschiedene Fragetypen sowie deren Vor- und Nachteile. Die im Folgenden dargelegte Einteilung orientiert sich an Haller, sie ist jedoch mit dessen Klassifikation nicht identisch. Die Hallersche Einteilung erfolgte aus einem rein publizistischen Blickwinkel, die angeführten Vor- und Nachteile fußen auf journalistischen Erfahrungswerten. Bei der hier dargestellten Einteilung wird versucht, die gesprächskonstitutive Funktion der jeweiligen Frage aus psychologischer Sicht zu betrachten. Darüber hinaus werden die einzelnen Fragetypen an Beispielen verdeutlicht, die sich auf eine wissenschaftsjournalistische Fragestellung beziehen (fiktive Beispiele)23. 1. Sachverhaltsfragen Definition: Sachverhaltsfragen zielen darauf ab, ein wissenschaftliches Phänomen zu explizieren (Entfaltung eines Wissensbestandes). Sachverhaltsfragen (bzw. faktizierende Fragen) können offen oder geschlossen gestellt werden; Sachverhaltsfragen können spezifisch (Wissensfragen) oder unspezifisch sein (Aufforderungs- und Motivierungsfragen). Sie können sich auf einen eng begrenzten Aspekt eines Sachverhaltes (z. B. Definitionsfragen) oder auf ein weites, nicht näher eingeschränktes Wissensfeld (Wissensfrage) beziehen. Bei der Sachfrage handelt es sich um eine übergeordnete Kategorie, unter die mehrere verschiedene Fragetypen subsumiert werden können (Wissens-, Definitions-, Aufforderungs- und Motivierungsfrage). Die Plattformfrage wird hier als Sonderfall einer sachbezogenen Frage eingestuft. Sie kann als „Grenzgängerin“ zwischen Interpretations- und Sachverhaltsfrage angesehen werden. Bei einer Plattformfrage wird zunächst ein Sachverhalt behauptet (z.B. „Viele übergewichtige Personen leiden ja unter Herzproblemen…Wie behandelt man…?) und dann – unter Bezugnahme auf diesen behaupteten Sachverhalt – eine Frage gestellt. Beispiel Wissensfrage Frau Dr. X., wie viele Menschen leiden unter einer Zwangskrankheit? Vorteil: Setzt richtige und überprüfbare Antworten voraus; gibt einem Interview die nötige Substanz Nachteil: unpersönlich; abstrakt Beispiel Motivierungsfrage Sie haben täglich mit Menschen zu tun, die unter psychischen Problemen leiden. Wie schaffen Sie es, ihren Beruf immer noch erfolgreich zu bewältigen? 23 Die Zusammenstellung der Fragen ist nicht wörtlich von Haller übernommen; es ist der Versuch, die Fragetypologie neu zu ordnen; außerdem soll die psychologische Konsequenz von Fragen deutlicher hervor treten als bei Haller. Die gewählten Beispiele sind konstruiert; sie wurden nach Sichtung verschiedener HR2-Sendung („Forum Leib und Seele“) zusammengestellt. Theorie 43 Vorteil: Befragte fühlt sich begrüßt; es entsteht Vertraulichkeit und gegenseitiger Respekt Nachteil: Gefahr der Anbiederung; Mangel an Distanz Beispiel Aufforderungsfrage Frau Dr. X., Sie forschen seit vielen Jahren über Zwangskrankheiten. Was fasziniert Sie eigentlich an diesem Forschungsfeld? Vorteil: Wirkt stark auffordernd; öffnet ein weites Antwortfeld Nachteil: Antwortverhalten lässt sich nicht steuern; Antworten evtl. zu vage Beispiel Definitionsfrage Frau Dr. X., können Sie uns den Begriff Zwang einmal definieren? Vorteil: Bewirkt eine Präzisierung des Themas; hat klärende Funktion Nachteil: Kann den Interview-Fluss behindern; kann als Aufforderung zum belehrenden Exkurs missverstanden werden Beispiel Plattformfrage Frau Dr. X., Studien zeigen, dass Psychotherapie wenig hilft. Welche Behandlungsmethoden sind denn wirksam? Vorteil: Klarer Ausgangspunkt des Gesprächs; zielgerichtete Interviewführung möglich Nachteil: Interviewer-Aussage muss inhaltlich stimmen, ansonsten kann es zu Irritationen führen 2. Verständnisfragen Definition: Verständnisfragen sind Anschlussfragen, sie setzen voraus, dass ein Sachverhalt bereits teilweise erläutert wurde. Verständnisfragen stehen im Dienst des Sachverhaltes und zielen darauf ab, eine Präzisierung, Raffung und Abklärung eines bestimmten Wissensfeldes zu bewirken. Verständnisfragen werden immer dann gestellt, wenn es dem interviewten Experten nicht gelungen ist, einen Sachverhalt ausreichend verständlich zu machen. Die einzelnen Typen von Verständnisfragen (abklärend, raffend, präzisierend) lassen sich in der Praxis schwer voneinander abgrenzen. Verständnisfragen sind Indikatoren eines nicht vollends geglückten Prozesses der Verständigung (s. hierzu Experten- Laien- Kommunikation). Psychologisch gesehen, ist die Verständnisfrage als Rückmeldung zu deuten, die dem Experten signalisiert, dass er weitere Anstrengungen unternehmen muss, um den von ihm dargelegten Inhalt laiengerecht darzustellen. Verständnisfragen sind reaktiv; sie verweisen im Sinne der Experten-Laien- Kommunikation auf eine suboptimale Antizipation der Laienperspektive. Durch Aussparen von bedeutungsrelevanten Inhalten (implizites Voraussetzen von Wissen), durch Verwenden von Fachausdrücken bzw. Fachkonzepten und durch „Überspringen“ von argumentativen (Teil-)Schritten kommt es zu Verständigungsproblemen. Verständnisfragen haben eine den Gesprächsverlauf verlangsamende Wirkung, ihnen wohnt ein retardierendes Moment inne. Solange ein Sachverhaltsaspekt nicht verständlich gemacht wurde, können nachfolgende Gesprächsstufen nicht durchlaufen werden. Beispiel: Präzisierende Verständnisfrage Sie sind also bei der Behandlung so vorgegangen wie andere Wissenschaftler vor Ihnen auch schon? Vorteil: Führt zu einer Klärung des Sachverhaltes, erhellt das Verständnis Nachteil: Die Verständnisfrage „verlangsamt“ das Gespräch; sie lässt den Interviewer als begriffsstutzig erscheinen. Außerdem kann die Verständnisfragen als Bevormundung empfunden werden. Beispiel: Abklärende Verständnisfrage Sie wählen diese neue spezielle Behandlung deshalb, weil die anderen Methoden schlechter sind? Vorteil: Führt zu einer Klärung des Sachverhaltes, erhellt das Verständnis Nachteil: Die Verständnisfrage „verlangsamt“ das Gespräch; sie lässt den Interviewer als begriffsstutzig erscheinen. Außerdem kann die Verständnisfragen als Bevormundung empfunden werden. Beispiel: Raffende Verständnisfrage Offenbar ist die neue Behandlungsmethode sehr stark darauf ausgerichtet, das gegenwärtige Verhalten zu verändern? Theorie 44 Vorteil: Führt zu einer Klärung des Sachverhaltes, erhellt das Verständnis Nachteil: Die Verständnisfrage „verlangsamt“ das Gespräch; sie lässt den Interviewer als begriffsstutzig erscheinen. Außerdem kann die Verständnisfragen als Bevormundung empfunden werden. 3. Interpretationsfragen Definition: Bei Interpretationsfragen unterbreitet der Interviewer (als Laie bzw. als symbolhafter Vertreter des Laienpublikums) dem Interviewten resp. dem Experten ein Interpretationsangebot: Der Interviewer versucht sich folglich darin, einen Sachverhalt bzw. ein Forschungsergebnis zu deuten und bietet diese Deutung dem Interviewten in Frageform probeweise an. Indem der Interviewer einen Sachverhalt resp. ein Phänomen zu interpretieren versucht, tritt er in Konkurrenz mit dem vom Experten bevorzugten Deutungsmodell. Dieser Fragetypus spielt im Zusammenhang mit Psychologie-Themen eine große Rolle. So haben Studien gezeigt, in welch hohem Maße psychologiehaltige Themen dazu zu prädestiniert sind, subjektive Deutungsmuster herauszufordern. Da psychologischen Themen eine hohes journalistisches Potenzial (im Sinne der Nachrichtenwerte Identifikation und Relevanz) zukommt, provozieren diese Themen auch eine „Abgleichung“ des dargelegten Forschungsbefundes mit den je eigenen Erfahrungen des Gegenübers. Indem sich der Laie auf seinen durch Erfahrung vermeintlich legitimierten Experten- Status beruft, stellt er den Status des tatsächlichen Psychologie- Experten indirekt in Frage. Aus diesem Grunde wundert es nicht, dass sich Psychologie-Experten mit höhere Wahrscheinlichkeit als andere Fachvertreter laienhafter Interpretationsversuche erwehren müssen: Wie die Forschung gezeigt hat, konkurriert die Psychologie mit dem „psychologischen Hausverstand“ des Laien. Psychologisch gesehen, wird durch die Interpretationsfrage der Experten- Status des Interviewten tendenziell unterminiert. Je nachdem, wie stark der Interviewer auf seinem Interpretationsangebot persistiert, wird auch Status des Experten in unterschiedlichem hohem Ausmaß unterlaufen: So kann der Interviewer seine Interpretation zögerlichfragend in den Raum stellen oder aber im Stile einer Behauptung bzw. Gewissheit kundtun. Das „Interpretationsangebot“ des Interviewers orientiert sich wiederum an bestimmten psychologietypischen Stereotypien. Als Vertreter eines (nicht näher spezifizierbaren) Laienpublikums aktualisiert er die Vorurteile, Ressentiments und „Stereotypien“, die psychisch Kranken sowie den Vertretern der Profession Psychologie entgegen gebracht werden. Beispiel: Interpretationsfrage (zaghaft) Sie nehmen den Patienten also immer ernst, auch wenn seine Symptome nicht so schlimm sind? Vorteil: Das Gesagte wird präzisiert, der Journalist zieht – stellvertretend für den Experten – eine Quintessenz aus dem bisher Gesagten Nachteil: Die Interpretation des Journalisten kann falsch sein; der Journalist muss damit rechnen, dass seine Deutung zurück gewiesen wird. Beispiel: Interpretationsfrage (bestimmt) Ist es nicht so, dass die Patienten sich ihre Symptome nur ausdenken, um Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten? Vorteil: Das Gesagte wird präzisiert, der Journalist zieht – stellvertretend für den Experten – eine Quintessenz aus dem bisher Gesagten Nachteil: Die Interpretation des Journalisten kann falsch sein; der Journalist muss damit rechnen, dass seine Deutung zurück gewiesen wird. Theorie 45 4. Kognitionsfragen Definition: Kognitionsfragen sind Anschlussfragen; durch sie wird der Experte angehalten, das von ihm Gesagte zu bewerten bzw. zu legitimieren. Die Kognitionsfrage ist eine Aufforderung über die eigene These (kritisch) zu reflektieren, weshalb dieser Fragetyp intellektuelle Spannung erzeugt. Mit der Kognitionsfrage ist ein Wechsel der Kommunikationsebene verbunden, da der Experte gezwungen wird, sich reflexiv auf das bereits Gesagte zu beziehen. Indem der Journalist den Experten mit einer Fremdposition bzw. mit einer kritischen Position konfrontiert, zwingt er ihn dazu, sich – im wahrsten Sinne des Wortes – zu erklären. Die Kognitionsfrage kann als provokativ, konfrontativ oder fordernd empfunden werden (aus Sicht des Befragten bzw. aus Sicht des Publikums). Durch die Kognitionsfrage wird ein Sachverhalt „hinterfragt“; dieser Fragetyp stellt eine dezidiert journalistische Technik dar, mit der es gelingen soll, das Gesagte resp. den Experten zu kontrollieren (Kontrollfunktion des Journalismus). Es lassen sich verschiedene Formen von Kognitionsfragen unterscheiden. Beispiel: Kritische Frage Sie haben geschildert, dass Sie mit Ihrer Therapie den Patienten helfen können. Haben Sie denn auch erfasst, bei wie vielen Patienten sich ihre Therapie negativ auswirkt? Beispiel: Provokative Frage Sie haben geschildert, welche Verbesserungen sich durch ihre Therapie einstellen. Jetzt würde mich einmal interessieren: Was wird durch ihre Therapie denn schlechter, welche „Nebenwirkungen“ hat ihre Therapie? Wenn Sie das einmal an einer „Fallgeschichte“ verdeutlichen könnten... Beispiel: Konfrontative Frage Sie sind von der Wirksamkeit der Verhaltenstherapie überzeugt. Die Studie von Professor Y hat aber doch gerade gezeigt, dass andere Verfahren wirksamer sind?! Beispiel: Einschätzungsfrage Frau Dr. X, sie behandeln seit vielen Jahrzehnten Menschen mit Zwänge. Können Sie diesen Menschen heutzutage wirklich besser helfen als vor dreißig Jahren? Die Fragetypen lassen sich auf vier Ebenen klassifizieren: • Die Fragen sind entweder auf die Person oder auf die Sache ausgerichtet. • Die Fragen sind direkt (Intention ist erkennbar) oder indirekt (Intention ist verdeckt). Bei indirekten Fragen ist die Frageintention nicht erkennbar, es kommt zu einer Verdoppelung der Bedeutungsebene. Indirekte Fragetypen wie zum Beispiel Indizienfragen werden nach Ansicht von Haller (1991) häufig als unfair und irreführend empfunden. Sie können – in Anlehnung an Groeben, Schreier & Christmann (1993) – als unintegere Fragetechniken bezeichnet werden. • Die Fragen führen zu einer mehr oder weniger starken „Retardierung“ (Verzögerung) des Gesprächs resp. des Gesprächsflusses. Theorie • 46 Die Fragen führen zu einer „Verengung“ (Fokussierung) bzw. „Weitung“ (Generalisierung) des Themas. Die Fragen dienen dem Zweck, dem interviewten Wissenschaftler bei der Entfaltung eines Wissensbestandes (einer wissenschaftlichen Erkenntnis bzw. eines wissenschaftlichen Phänomens) lenkend „zur Seite zu stehen“. In der publizistischen Literatur wird die psychologische Funktion der jeweiligen Fragetypen bisher ausgeblendet. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Fragetypen qualitativ unterschiedliche Formen der Entfaltung von Wissensbeständen „provozieren“. Der Journalist hat die Erwartung, dass eine Sachverhalts- bzw. Verständnisfrage den Wissenschaftler dazu veranlasst, ein wissenschaftliches Phänomen (Zwang; Placebo; Arbeitslosigkeit) „laien- gerecht“ zu beschreiben; die hierfür zur Verfügung stehenden sprachlichen Mittel sind funktional auf den Zweck der Popularisierung eines wissenschaftlichen Sujets hin ausgerichtet. Interpretations- und Kognitionsfragen bedingen eine auf Argumente gestützte Darlegung einer wissenschaftlichen These und provozieren ein apologisierendes Antwortverhalten; Sachverhaltsund Verständnisfragen bewirken eine phänomenologische Darlegung eines Sachverhaltes. Als „phänomenologische Explikation“ gelten jene sprachlichen Mittel, mit denen es gelingt, einen wissenschaftlichen Gegenstand in die „normale“ Erfahrungswelt des Laien „einzugliedern“ bzw. zu integrieren. Die Notwendigkeit, ein Thema sprachlich und konzeptuell „herunter zu brechen“, wird vom Journalisten nicht hinter fragt; vielmehr leitet sich aus der Einsicht in diese Notwendigkeit das berufliches Selbstverständnis des Journalisten ab. Die Einsicht in die Notwendigkeit, sich in die Perspektive des Anderen, des „Unwissenden“, hinein zu versetzen, kann auf Seiten des Interviewten nicht per se als gegeben angesehen werden. Und in Anbetracht der Tatsache, dass der Adressat eines Interviews nicht genauer bestimmbar ist, ist es auch nicht möglich, die Güte der verwirklichten Perspektivenübernahme zu objektivieren. Allerdings repräsentiert der Interviewer symbolhaft den Laien resp. das Laienpublikum; er ist der Vertreter dieses Publikums und handelt in dessen Auftrag. Die Kommunikation zwischen Psychologie- Experte und Journalist ist somit ein Sonderfall der Experten- Laien- Kommunikation. Aus Sicht der Experten-Laien-Kommunikation lässt sich zwischen einer phänomenlogischen und einer evaluativen Explikation eines wissenschaftlichen Sachverhaltes unterscheiden: Bei der phänomenologischen Explikation wird der Sachverhalt definiert, erläutert und geklärt, d.h. das wissenschaftliche Phänomen wird entfaltet (Orientierungsfunktion); bei der evaluativen Explikation wird der bereits entfaltete Sachverhalt (bzw. die damit verbundene wissenschaftliche These) eingeschätzt und bewertet. Eine gelungene Kommunikation zwischen Experte und Laie umfasst sowohl die phänomenologische als auch die evaluative Explikation des wissenschaftlichen Tatbestandes, wobei die phänomenologische Explikation der evaluativen notwendigerweise voraus geht. Übertragen auf den Sonderfall der Kommunikation zwischen Experte und Journalist im medialen Kontext, lässt sich ein idealer Gesprächsverlauf beschreiben. Theorie 47 Abbildung 4: Überblick über den idealen Verlauf eines Interviews zwischen PsychologieExperte und Journalist (illustriert an einem fiktiven Beispiel) Interview-Frage 1: Woran erkennt man eigentlich, ob jemand unter einem Zwang leidet? Verständlichmachen des Forschungsfeldes evtl. kritische Nachfrage Frau X. erklärt, was eine Zwangserkrankung ist. Interview-Frage2: Worin unterscheidet sich diese Erkrankung denn von anderen psychischen Krankheiten? Verständlichmachen des Forschungsfeldes evtl. kritische Nachfrage Frau X. macht deutlich, worin das „Spezifische“ einer Zwangserkrankung besteht. Interview-Frage 3: Was haben Sie im Zuge Ihrer Forschung herausgefunden? Herausstellen des eigenen Forschungsergebnisses evtl. kritische Nachfrage Frau X. legt das „Neue“ bzw. das Ergebnis seiner Forschung da. Interview-Frage 4: Sie haben heraus gefunden, dass…Wie sind Sie dabei vorgegangen? Darlegen der wiss. Methode evtl. kritische Nachfrage Frau X. erläutert die „Wissenschaftlichkeit“ des Vorgehens. Interview-Frage 5: Inwieweit unterscheiden sich ihre Ergebnisse von den Ergebnissen Anderer Wissenschaftler? Annähern bzw. Abgrenzen der eigenen Position von einer Fremdposition evtl. kritische Nachfrage Frau X. betont, dass die Ergebnisse im Widerspruch zur bisher gültigen Befundlage stehen bzw. dass die Ergebnisse mit der bisherigen Befundlage (teilweise) in Einklang stehen. Interview-Frage 6: Was für Schlüsse lassen sich aus Ihrer Forschung ziehen? Bewerten des eigenen Forschungsbefundes evtl. kritische Nachfrage Frau X. legt dar, worin der Nutzen der Forschung besteht bzw. bestehen könnte. Theorie 48 Wird ein bestimmtes wissenschaftliches Konzept nach Ansicht eines Wissenschaftsjournalisten nicht verständlich genug erklärt, so wird dieser nachfragen und um eine Präzisierung des Gesagten bitten. Durch Sach- und Verständnisfragen versucht der Journalist, den dargelegten Sachverhalt weiter zu vereinfachen, zu konkretisieren, zu „entwissenschaftlichen“. Das Nachfragen aber stellt ein retardierendes Moment dar, es stört den Fluss des Gesprächs (s. Haller, 1991; Friedrichs & Schwinges, 1999). Das fortwährende Insistieren auf einem bestimmten Teilaspekt eines wissenschaftlichen Sujets behindert nicht nur das Gespräch, es läuft auch der Grundintention des Gespräches zuwider: Das journalistische Gespräch bzw. Interview ist nämlich primär darauf ausgerichtet, ein wissenschaftliches Konzept bzw. eine wissenschaftliche These zu bewerten und mit der Lebenswelt des Zuschauers bzw. Zuhörers in Beziehung zu setzen. Erst durch die Re- Kontextualisierung eines wissenschaftlichen Phänomens wird dessen journalistisches Potenzial erkennbar. Indem der Wissenschaftsjournalist das behandelte Thema in den „Lebenskontext“ des Zuhörers „einfügt“, legitimiert er das Thema als journalistisch relevanten Sachverhalt. Es reicht aus Sicht des Journalisten folglich nicht aus, den Sachverhalt zu erhellen, sondern er muss darüber hinaus versuchen, die praktische Relevanz eines Forschungsgegenstandes heraus zu arbeiten. Während es dem WissenschaftsJournalisten mittels Verständnis- und Sachfragen eher gelingt, den Sachverhalt als solchen zu erläutern, sind Kognitions- bzw. Interpretationsfragen eher dazu geeignet, eine Bewertung bzw. eine Einschätzung des in Frage stehenden Gegenstandes zu ermöglichen. Durch die Wahl des Fragetyps evoziert der Interviewer beim Interviewten einen bestimmten Antwort-Stil. Der Fragestil ist nämlich mehr als eine bloß rhetorische Figur, er ist aus psychologischer Sicht ein kommunikatives Mittel, mit dem sich das Selbstwertgefühl des Interviewten stärken oder schwächen lässt. Abbildung 5: Interdependenz zwischen Fragemodus und Art der Explikation Sachverhaltsfragen Verständnisfragen Explizite Erläuterung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Kognitionsfragen Interpretationsfragen Explizite Verteidigung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Theorie 49 2.3.1. Laienorientierung als interaktionales Phänomen Das Ausmaß an Laienorientierung, das ein Experte im Interview realisiert, wird vom Verbalverhalten des Journalisten mitbestimmt. Auf der Grundlage des Forschungsstandes auf dem Gebiet der psychologischen Medienwirkungsforschung ist mit folgenden „Interaktionseffekten“ zwischen Journalist und Experte zu rechnen: 1. Veränderung der argumentativen Strategie (zweiseitige statt einseitige Argumentation) 2. Vorwegnahme (möglicher) gegnerischer Argumente (kognitive Impfung) 3. Verteidigung des Experten-Status durch Aufgeben der Laienperspektive (kognitiver Widerstand) 2.3.1.1. Zweiseitige Argumentation In der Medienwirkungsforschung wird zwischen einseitiger und zweiseitiger Argumentation unterschieden: Führt eine Person nur solche Argumente an, die eine von ihr vertretene These stützen, so bezeichnet man diese Argumentation als einseitig; führt eine Person auch mögliche Einwände bzw. Gegenargumente an, die nicht oder nur teilweise im Einklang mit der behaupteten These stehen, so bezeichnet man diese Argumentation als zweiseitig (Schenk, 2002). Die Unterscheidung zwischen einseitiger und zweiseitiger Argumentation ist bei der Kommunikation wissenschaftlicher Themen besonders wichtig, schließlich macht es einen großen Unterschied, ob ein Experte z. B. die Wirksamkeit einer neuen Therapiemethode einseitig heraus stellt oder ob er gleichfalls die „Nachteile“ des neuen Verfahrens thematisiert. Durch eine zweiseitige Argumentation ist es sowohl möglich, positive Argumente besonders hervor zu heben als auch negative Argumente (Gegenargumente) zu entkräften (s. 2.3.1.2.). Die Überlegenheit der zweiseitigen Argumentation gegenüber der einseitigen konnte belegt werden: Zum einen ist es eher möglich, Rezipienten durch eine zweiseitige Argumentation zu überzeugen als durch eine einseitige (Hovland, Lumsdaine & Sheffiled, 1949; zit. nach Schenk, 2002); zum andern wird eine zweiseitige Argumentation für glaubwürdiger gehalten (Chu, 1967). Insbesondere die höhere Glaubwürdigkeit zweiseitiger gegenüber einseitiger Argumentation konnte in zahlreichen Studien nachgewiesen werden, wenngleich diese Befunde größtenteils aus der Konsumentenforschung stammen und sich daher nicht so ohne weiteres auf den Bereich der Wissenskommunikation übertragen lassen (Kamins & Marks, 1987; Swinyard, 1981; Pechmann, 1992). Unter Rückgriff auf die Attributionstheorie haben Golden & Alpert (1987) die Überzeugungskraft zweiseitiger Argumentationstechniken zu erläutern versucht. Ihrer Meinung nach wird rollendis- Theorie 50 krepantes Verhalten dispositional attribuiert. Das heißt konkret: Einem Verkäufer, der auch die Nachteile seines Produktes erwähnt (zweiseitige Argumentation), wird die Disposition „Ehrlichkeit“ zuerkannt, weshalb seine Äußerungen für glaubwürdiger gehalten werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch Wissenschaftler eine höhere Glaubwürdigkeit erzielen, wenn sie ihre Forschungstätigkeit nicht einseitig in ein positives Licht rücken, schließlich „verkaufen“ Wissenschaftler auch ein Produkt (nämlich ihre Forschungsbefunde oder ihre Behandlungsmethode). Allerdings genießen Wissenschaftler bzw. Experten einen besonders hohen öffentlichen Vertrauensvorschuss, weshalb eine etwaige einseitige Argumentation nur in seltenen Fällen Argwohn auslöst. Anders als bei einem Verkäufer verhält sich ein Wissenschaftler keinesfalls rollendiskrepant, wenn er zweiseitig argumentiert. Im Gegenteil: Das abgewogen- zweiseitige Argumentieren gilt aus Sicht von Journalisten als typisches Rollenverhalten von Wissenschaftlern! Und noch etwas unterscheidet einen Wissenschaftler vom Verkäufer eines Produktes: Während das Produkt, das etwa ein Staubsaugervertreter anpreist, sogleich auf seine „Qualitäten“ hin geprüft werden kann, lässt sich die Güte eines wissenschaftlichen Befundes oder einer neuen Behandlungsmethode nicht so ohne weiteres überprüfen. Aus diesen Gründen erscheint es nicht zulässig, die Ergebnisse der Konsumentenforschung – in einer Art Analogieschluss – auf die Experten-Laien-Kommunikation im medialen Kontext zu übertragen. Im Hinblick auf die konkrete Interviewsituation zwischen einem Experten und einem Laien (bzw. einem Journalisten) lässt sich die „Überlegenheit“ der zweiseitigen Argumentation auch mit der Reaktanztheorie von Jones & Brehm (1970) erklären. So löst einseitige Argumentation immer dann Reaktanz bzw. Widerstand aus, wenn der Rezipient der Äußerung glaubt, dass ihm wichtige Informationen vorenthalten werden. Je besser ein Zuschauer bzw. Zuhörer über mögliche Gegenargumente vorab informiert ist, desto eher lehnt er eine einseitig geführte Argumentation bezüglich eines bestimmten Sachverhaltes ab und desto stärker empfindet er eine solche Argumentationsform als Beschränkung seiner individuellen Entscheidungsfreiheit (Brehm, 1966). Ist ein Journalist mit einem wissenschaftlichen Sachverhalt gut vertraut, so löst eine einseitige Argumentation durch den Experten bei ihm eher Reaktanz aus als bei einem Journalisten, der inhaltlich ahnungslos ist und sich deshalb gar nicht gewahr wird, welche Informationen ihm vorenthalten werden. Das Beispiel zeigt, dass die ein- bzw. zweiseitige Argumentation während einer Interaktion unterschiedliche psychologische Konsequenzen zeitigt, je nachdem, wie groß die Wissenskluft zwischen zwei Interaktionspartnern ist. Die spezifische Auswirkung einer bestimmten Argumentationstechnik lässt sich folglich nicht jenseits der kommunikativen „Ausgangslage“ bestimmen. Der Journalist verkörpert jedoch keinen passiven Rezipienten, wie das in den Medienwirkungsstudien zur „Zweiseitigen Argumentation“ zumeist angenommen wird. Vielmehr stellt er einen aktiv handelnden Interaktionspartner dar, der seine „Reaktanz“ zu verbalisieren versucht: In dem Augenblick, in dem ein Journalist sich nicht ausreichend informiert fühlt, entsteht bei ihm ein „inne- Theorie 51 rer Widerstand“ gegen das Gesagte, den er durch das Aufzeigen von Gegenargumenten „abzuschwächen“ gewillt ist. Einseitige Argumentationen provozieren somit kritische Nachfragen und Einwände, durch die wiederum eine Korrektur der einseitigen Argumentationsstrategie nötig wird. Tatsächlich lösen einseitige Argumentationsfiguren vermehrt kritisch-negative Gedanken aus, wohingegen zweiseitige Argumentationen eher positive und begünstigende Gedanken evozieren, wie Hale, Mongeau & Thomas (1991) nachweisen konnten. Die einseitige Argumentation löst beim Interaktionspartner folglich nicht nur einen psychischen Zustand aus (Reaktanz), sondern sie beeinflusst ihrerseits die kommunikative Haltung des Interaktionspartners. Ob die ein- oder zweiseitige Argumentation überzeugender wirkt, hängt dabei vom Wissen ab, über das die Interaktionspartner hinsichtlich eines bestimmten Sujets verfügen. Bereits Hovland (1949, zit. nach Schenk, 2002) konnte zeigen, dass der Faktor „Vorwissen“ eine vermittelnde Variable darstellt, von der die Wirkung der jeweiligen Argumentationstechnik beeinflusst wird. Darüber hinaus hat auch die Einstellung des Gegenübers einen Einfluss darauf, welche der beiden Argumentationstechniken überzeugender wirkt. Bei einer kritischen oder sogar feindlichen Einstellung des Gegenübers hat sich die zweiseitige Argumentation als überlegen erwiesen (Sawyer, 1973). Bei Zuhörern, die bereits eine Gegenmeinung vertreten, ist es besonders sinnvoll, zweiseitig und ausgewogen zu argumentieren, um den bereits vorhandenen inneren Widerstand des Rezipienten nicht noch zusätzlich zu steigern (Lumsdaine & Janis, 1953). Im Falle eines kritisch geführten Interviews zwischen einem Experten und einem Journalisten übernimmt der Journalist qua Profession eine kritische Position: Er sieht seine Aufgabe darin, die Äußerung des Experten kritisch zu hinterfragen. Bei einer solchen kontextuellen Voraussetzung des Gespräches ist es aus Sicht des Experten von vornherein angezeigt, zweiseitig zu argumentieren. Zieht der Journalist die „Glaubwürdigkeit“ der Quelle (und damit auch die Glaubwürdigkeit der angeführten Informationen) nicht in Zweifel, was sich in einem sachlich- wohlwollenden Fragestil ausdrückt, so wirken die Argumente des Experten u. U. auch dann überzeugend, wenn sie einseitig vorgetragen werden (s. hierzu Cook, 1969). Die einseitige Argumentation ist indes immer dann besonders problematisch, wenn der Rezipient bzw. Gesprächspartner den Eindruck gewinnt, dass er von einem bestimmten Sachverhalt überzeugt werden soll (Brock, 1967). Nur solange die persuasive Absicht einer Kommunikation nicht offenbar wird, erscheint es ratsam, einseitig zu argumentieren. Je größer das Wissen einer Person und je kritischer ihre Haltung hinsichtlich eines bestimmten Themas, desto eher wird sie sich des gewollt persuasiven Charakters einer einseitig vorgetragene These bewusst werden – und evtl. dazu verleitet sein, diese These durch das Formulieren von Gegenmeinungen zu hinterfragen. Theorie 52 2.3.1.2. Kognitive Impfung Bei der zweiseitigen Argumentation werden mögliche kritische Einwände bzw. Gegenargumente gedanklich vorweg genommen und nach Möglichkeit „entschärft“. Durch das Einbeziehen der Gegenposition gelingt es, die persuasive Kraft einer solchen Gegenposition abzumildern. Das bloße Nennen von Gegenargumenten (nonrefutionale Argumentation) ist dabei weniger überzeugend als das inhaltliche Entkräften der genannten Gegenargumente (refutionale Argumentation). Nach einer Metaanalyse von Jackson & Allen (1987) ist eine zweiseitige Argumentation dann besonders erfolgreich, wenn sie die Gegenposition aufgreift und widerlegt. Werden Einwände lediglich erwähnt und nicht widerlegt, so kann diese zweiseitige Argumentationstaktik im Zweifelsfall sogar negativer wirken als eine ausschließlich einseitige Argumentation (Allen, 1991). Ist es nicht möglich, einen Einwand gänzlich zu widerlegen, so sollte zumindest darauf geachtet werden, diesem Einwand die eigenen Argumente inhaltlich gegenüber zu stellen, um die Gegenposition „aufzuwiegen“. In einer (medialen) Situation, in der ein Redner damit rechnen muss, kritisch befragt zu werden, ist es nach Crowley & Hoyer (1994) besonders ratsam, möglichst rasch auf gegnerische Einwände einzugehen, wobei die Gegenposition nicht sofort zu Beginn genannt werden sollte. Solange die Glaubwürdigkeit eines Redners garantiert ist – und seine Aussagen deshalb Gehör finden – sollte er sein eigenes Argument zeitlich nach dem angeführten Gegenargument präsentieren, da das letztgenannte Argument nach Ansicht von Hass & Lindner (1972) mehr Wirkung entfaltet als das erstgenannte Argument. Durch die Vorwegnahme gegnerischer Argumente erhöht sich zum einen die Glaubwürdigkeit eines Redners (Allen et. al., 1990); zum andern sind zweiseitige Argumentationen resistenter gegenüber verbalen Angriffen. Die Aussicht, kritisch befragt zu werden (mittels Kognitionsfragen) dürfte die Bereitschaft eines Redners fördern, seine Argumente zweiseitig zu gestalten – und sich so gegen mögliche Einwände abzusichern. Durch die Aufnahme von Gegenargumenten in die eigene Argumentation gelingt es – zumindest bei stichhaltiger Argumentation – einen konsistenten Eindruck aufrecht zu erhalten, der eben gerade durch die Berücksichtigung möglicher widersprechender Argumente bestehen zu bleiben vermag: Ist es einmal gelungen, eine Gegenposition in die eigene Position zu „integrieren“, so ist diese Argumentation weitestgehend immun gegenüber weiteren, inhaltlich anders gearteten Einwänden (Papageorgis & McGuire, 1961). Der Rezipient (bzw. der Journalist) solcher zweiseitig gestalteter Argumente ist nach Ansicht von McGuire kognitiv geimpft worden: Durch die Widerlegung eines speziellen Gegenargumentes ist er gegen weitere, inhaltlich anders zusammen geartete Gegenargumente immunisiert worden (Tannenbaum, 1967). Theorie 53 Nimmt ein Experte im Gespräch die Position des Journalisten vorweg und versucht diese sodann zu entkräften, so lässt sich dieses verbale Verhalten als Journalisten-Orientierung bzw. MedienOrientierung im engeren Sinne begreifen. Indem der Experte die kritische Haltung des Journalisten antizipiert, ruft er sich die möglichen „Schwachstellen“ seiner Argumentation ins Bewusstsein – und kann diese „Schwachstellen“ dann (selektiv und in „strategischer“ Absicht) offen legen. Durch einen kritischen Fragestil wird die Rolle des Journalisten als „Kontrollinstanz“ aktualisiert, wodurch der Experte subjektiv die Notwendigkeit erkennt, möglichen Gegenargumenten oder Einwänden durch zweiseitige Argumentation zuvorzukommen. 2.3.1.3. Kooperation und kognitiver Widerstand Gemäß der oben angeführten Reaktanztheorie von Brehm (1966) löst die einseitige Argumentation einen inneren Widerstand beim Rezipienten aus. Bei einer Interaktion sind die Gesprächspartner – in zeitlichem Wechsel – sowohl Produzenten als auch Rezipienten von Informationen, weshalb es auf beiden Interaktionsseiten zur Bildung von Reaktanz kommen kann. Im Falle einer ExpertenJournalisten-Kommunikation muss von einem wechselseitig bedingten Reaktanzproblem ausgegangen werden: Während die einseitige Argumentation eine Reaktanzbildung auf JournalistenSeite begünstigt, führt ein kritischer Fragestil auf Experten-Seite dazu, dass sich der Experte hinter sein Expertentum zurückzieht. Dieses „Sich- Zurückziehen“ kann als Reaktanz verstanden werden – oder doch zumindest als Ausdruck aufgekündigter Kooperationsbereitschaft. Der befragte Experte, den kritischen Fragemodus des Journalisten als (mehr oder weniger direkten) Angriff auf seinen Experten-Status wertend, sieht sich legitimiert, die Laienorientierung durch eine stärkere Expertenorientierung zu ersetzen. So wie die einseitige Argumentation beim Journalisten den Eindruck hervorruft, man wolle ihm Informationen vorenthalten, so lässt die kritische Frage beim Experten den Eindruck entstehen, man wolle ihm seinen Experten-Status streitig machen oder diesen Status diskreditieren. Durch kritisches Fragen vergewissert sich der Journalist seines eigenen Status – und stellt dadurch seinen berufsbedingten Selbst-Anspruch heraus; durch einen Rückzug auf die Expertensprache (und damit durch ein Aufgeben der initiierten Laienorientierung) vergewissert sich wiederum der Experte seines Status´ – und stellt die „Differenz“ zwischen sich und dem Journalisten bzw. dem Publikum wieder her. In dem Augenblick, in dem der Experte sich verteidigen muss (und damit in eine defensive Lage gerät), entwickelt er evtl. einen kognitiven Widerstand gegen die vom Journalisten erhobene Forderung, seine wissenschaftlichen Inhalte weiter zu popularisieren und laiengerecht offen zu legen: In die Rolle gedrängt, sich gegen Vorwürfe oder Einwände verteidigen zu müssen, zieht sich der Experte mit hoher Wahrscheinlichkeit auf sein Expertentum zurück – und widersteht so jeder Forderung, seine Inhalte so laien- bzw. mediengerecht aufzubereiten. Theorie 54 Das Ausbilden von kognitivem Widerstand ist das Ergebnis eines interaktionalen Vorganges. Das Maß der gezeigten Laienorientierung ist weniger ein Hinweis darauf, ob eine Person fähig bzw. willens ist, sich einfach und unprätentiös auszudrücken, sondern es ist ein Indikator dafür, ob der eigenen Status während des Interviews als gesichert angesehen wird oder nicht. Journalisten erwarten von Wissenschaftlern, dass sie während eines Gesprächs kooperationsbereit sind. Als ein wichtiger Indikator für kooperatives Verbalverhalten kann nach Ansicht von Grice (1975) die Tendenz gewertet werden, den Aussagen bzw. Fragen des Gegenübers (bzw. des Journalisten) zuzustimmen. Die Ja-Sage-Tendenz ist weit verbreitet; Personen neigen grundsätzlich dazu, Aussagen eher zu bejahen als zu verneinen (Blau & Katerberg, 1982). Durch Suggestiv-Fragen provoziert der Journalist eine Bejahung bzw. Akquieszenz. Stimmt der Wissenschaftler einer Aussage bzw. einem „Interpretationsangebot“ auch dann zu, wenn er inhaltlich davon nicht gänzlich überzeugt ist, so weist ein solches pragmatisches Verbalverhalten darauf hin, dass der interviewte Wissenschaftler besonders kooperationswillig ist. Obgleich er eine vom Journalisten nahe gelegte Deutung (tendenziell) ablehnt, weist er das Interpretationsangebot nicht zurück, sondern versucht ein positives und kooperatives Gesprächsklima aufrecht zu erhalten: Trotz kognitiven Widerstandes gegen die Aussagen des Journalisten wird an einer Bejahung der Aussagen fest gehalten. Ein solches Verhalten kann als besonders starker Indikator für Kooperationsbereitschaft gewertet werden; in ihr drückt sich implizit auch eine hohe Akzeptanz aus, die der Wissenschaftler einer journalistischen Perspektive entgegen bringt. In der Praxis beobachtet man nicht selten folgendes Muster: Eine Aussage wird zunächst formal bejaht, dann aber inhaltlich revidiert. Nach Alt (1993) handelt es sich hierbei um einen argumentativen Trick, der evtl. zu einem unklaren Meinungsgemenge führt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Journalisten v. a. jene Wissenschaftler schätzen, die sehr stark bereit sind, die „journalistische“ Sicht auf ein Thema „abzusegnen“ bzw. zu bejahen. Allerdings ist eine hohe Kooperationsbereitschaft (bzw. eine starke Tendenz zur Akquieszenz) aus Sicht des interviewten Experten nicht unproblematisch: Indem er sich kooperationswillig zeigt, sichert er die Interpretationsmacht des Journalisten – und verliert die Botschaft aus dem Blick, die er selbst zu vermitteln gewillt war. Die Bereitschaft, auf die Aussagen des Journalisten direkt Bezug zu nehmen (etwa durch Sätze wie „Ich möchte anknüpfen, an das was Sie gesagt haben...“) und die Fähigkeit, das „Publikum“ mit einzubeziehen (etwa durch Sätze wie „Das kennen unsere Zuschauer wahrscheinlich aus eigener Erfahrung“), stellen weitere gesprächspragmatische Verbalhandlungen dar, die von Journalisten geschätzt und erwartet werden (s. Metakommunikation und Einbezug im Sinne Rambows, 2003)24. 24 Metakommunikation im Sinne eines gesprächsbegleitenden Kommentierens der Journalistenfragen (z.B. „Das ist eine interessante Frage“) werden von Journalisten jedoch nicht geschätzt. Theorie 55 2.3.2. Erwartungen der Journalisten an die Kommunikation mit Experten Wissenschaftler sehen ihre Rolle darin, die Öffentlichkeit zu informieren; sie klären gerne über ein wissenschaftliches Phänomen (z.B. ein Behandlungstechnik oder eine wissenschaftliche Erkenntnis) auf; die Rolle des „Beurteilers“ fällt ihnen hingegen wesentlich schwerer. Medien erwarten von Wissenschaftlern, dass sie über die Rolle des „Lehrers“ bzw. „Aufklärers“ hinaus andere Rollen wahrnehmen. Tabelle 9: Überblick über die verschiedene „mediengerechte“ Interview-Rollen von Wissenschaftlern Medien-Rolle Experte als „Schiedsrichters“ Experte als „Ratgeber“ Experte als „Warner“ Beispielhafte Aussagen (fiktiv) „Bei der Behandlung depressiver Störungen ist die Forschung in den letzten Jahren nicht voran gekommen“ „Falls Sie bei sich Symptom XY beobachten, sollten Sie sich nicht scheuen, einen Therapeuten aufzusuchen.“ „Es ist zu wenig bekannt, welche negativen psychische Folgen es hat, wenn ein Mensch arbeitslos ist“ Die laiengerechte Vermittlung eines wissenschaftlich bedeutsamen Sachverhaltes setzt sowohl die Bereitschaft voraus, über einen wissenschaftlichen Gegenstand „neutral“ zu informieren (a) als auch die Bereitschaft, diesen wissenschaftlichen Gegenstand kritisch zu prüfen bzw. zu verteidigen (b). Die laiengerechte Vermittlung eines Wissenschaftsthemas kann nur dann als geglückt gelten, wenn das behandelte Thema nicht nur auf verständliche Weise „entfaltet“ wird, sondern wenn das explizierte Thema darüber hinaus bewertet wird. Bei der Beurteilung eines wissenschaftlichen Phänomens können die folgenden Aspekte berücksichtigt bzw. vom Journalisten „abgefragt“ werden: • Vorteile (Chancen) und Nachteile (Gefahren) eines Forschungsfeldes • Praktischer Nutzen eines Forschungsfeldes (Anwendbarkeit bzw. „Verwertbarkeit“) • (Zukünftiges) Potenzial eines Forschungsfeldes (Perspektivische Bewertung) • Ethische und moralische Konsequenzen, die sich aus einer bestimmten Forschungstätigkeit ergeben • Stimmigkeit einer wissenschaftlichen These bzw. eines wissenschaftlichen „Konstruktes“ (Gültigkeitsbereich der gewonnenen Erkenntnisse) Theorie 56 Experten bzw. Wissenschaftler sehen das Ziel der Experten-Laien-Kommunikation im Wesentlichen darin, einen Sachverhalt zu erläutern – im Zuge ihrer „Vermittlungstätigkeit“ spielen die Dimensionen „Bewertung“ und „Potenzial“ (im Sinne Rambows, 2003) keine besonders wichtige Rolle. Bei Journalisten bzw. Wissenschaftsjournalisten verhält es sich i. d. R. umgekehrt: Sie halten eine „Vermittlung“ dann für laiengerecht, wenn die „Qualität“ (Brauchbarkeit) einer wissenschaftliche These eingeschätzt bzw. wenn der Nutzen einer wissenschaftlichen These kritisch reflektiert wird. Bei der klassischen Experten-Laien-Kommunikation entscheidet der „Experte“ eigenständig darüber, welche Formen der Laienorientierung er verwirklichen möchte; bei einer durch Journalisten „gelenkten“ Experten-Laien-Kommunikation rücken notwendigerweise jene „Indikatoren“ in den Vordergrund, die dem „journalistischen Auftrag“ entsprechen. Die Kommunikation zwischen Experte und Journalist unterscheidet sich insofern von der herkömmlichen Experten-LaienKommunikation als dass der Journalist den Vermittlungsprozess auf die seiner Ansicht nach relevanten Aspekte zu „verengen“ versucht. Tabelle 10: Dimension Explizite Bewertung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Nutzen Bewertung des Nutzens einer wissenschaftlich fundierten Anwendungsmöglichkeit (Therapie, Coaching, Training) Potenzial Bewertung des Potenzials einer wissenschaftlichen Erkenntnis im Hinblick auf zukünftige Handlungsoptionen Erkenntniswert Bewertung des Erkenntnisgewinns, der mit einer bestimmten Forschungsfrage verbunden ist Machtanspruch Bewertung der Legitimität eines erhobenen Machtanspruches Stimmigkeit Bewertung der Qualität bzw. Stimmigkeit einer These oder eines Fachkonzeptes Journalisten haben bestimmte Erwartungen darüber, wie sich ein Experte idealiter verhalten sollten (Göpfert & Ruß-Mohl, 1996). Diese normativen Erwartungen beziehen sich sowohl auf die Art und Weise, wie ein Experte seine Inhalte darlegen sollte als auch auf sein – nicht an einen bestimmten Inhalt gebundenes – interaktionales sowie pragmatisches Gesprächsverhalten. Folgende Erwartungen lassen sich unterscheiden: Theorie 57 1. Erwartungen hinsichtlich der inhaltlichen Darlegung des wissenschaftlichen Sachverhaltes (inhaltsspezifische Faktoren) 2. Erwartungen hinsichtlich des pragmatisch-kommunikativen Expertenverhaltens (inhaltsunspezifischer Faktoren) Die pragmatischen Verbalhandlungen lassen sich jenseits eines spezifischen Inhaltes bestimmen; sie sind jedoch nicht inhaltsfrei. Die weiter unten vorzustellenden pragmatisch-kommunikativen Handlungen sind stets auf einen Inhalt bezogen – und nur durch diese Rückbezüglichkeit verstehbar. Manche pragmatischen Verhaltensweisen sind mit nonverbalen Handlungen assoziiert (z.B. Ja-Sage-Tendenz und Lachen). Vollzieht sich eine Experten- Laien- Kommunikation im medialen Kontext, so ist der Experte dazu aufgefordert, explizite Schlussfolgerungen zu ziehen. Journalisten erwarten von Experten, dass sie eine argumentativ fundierte Spitzenformulierung nicht nur darlegen, sondern dass sie die realpraktischen bzw. gesellschaftlich- politischen Konsequenzen aufzeigen, die sich aus einer theorieoder thesenkonstituierenden Argumentationskette ergeben. Diese Schlussfolgerungen können deskriptiver oder normativer Natur sein. Bei einer deskriptiven Schlussfolgerung wird ein (erstrebenswerter) Zustand beschrieben, aber nicht direkt eingefordert; bei einer normativen Schlussfolgerung wird eine imperativische Forderung aufgestellt, wie man sich zu verhalten hat bzw. welche Veränderungen einzuleiten sind (Bayer, 1999). So wie aus Sicht von Journalisten die Konsequenz einer behaupteten wissenschaftlichen These aufgezeigt werden sollte, so sollte gleichfalls die handlungspraktische Konsequenz aufgezeigt werden, die sich aus einer bestimmten Störung (Was bedeutet es, unter einer spezifischen psychischen Störung zu leiden?) oder aus einer berufsspezifischen Interventionstechnik ergibt (Welche Folgen hat es, wenn eine Person an einem spezifischen Trainingsprogramm teilnimmt und woran lassen sich diese Folgen ablesen?). Das Aufzeigen von Konsequenzen ist von zentraler Bedeutung; alle Teilaspekte eines wissenschaftlichen Sachverhaltes (Fachkonzept, These, Handlungsrepertoire der Profession, Klient, etc.) sollten nach Möglichkeit so dargelegt werden, dass für den Laien erkennbar wird, welche Konsequenzen es z. B. hat, unter einer bestimmten Störung zu leiden, welche Folgen es nach sich zieht, wenn eine bestimmte wissenschaftliche These sich empirisch bestätigen sollte oder was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn sich eine bestimmte Interventionstechnik als wirksam oder unwirksam erweist. Erst dann, wenn die Konsequenzen wissenschaftlichen Handelns plausibilisiert werden, kommt es zur „Anbindung“ des Themas an die Lebens- und Erfahrungswelt des Zuschauers: Das Thema wird aus dem Kontext „Wissenschaft“ heraus gelöst und neu kontextualisiert. Durch das explizite Aufzeigen von (praktischen, gesellschaftlichen, politischen oder individuellen) Konsequenzen, die sich aus einem wissenschaftlichen Tatbestand ergeben, wird die Relevanz des Theorie 58 behandelten Themas offenbar. Und aus Sicht des Journalisten ist Relevanz ein Nachrichtenwert, an dem sich die journalistische Qualität bzw. das journalistische Potenzial eines Themas bemisst. Die Erwartungshaltung des Journalisten fußt auf der Überzeugung, dass es journalistische Nachrichtenwerte wie z. B. Relevanz, Aktualität, Überraschung, Konflikt und Identifikation sind, an denen sich die Qualität eines wissenschaftlichen Themas ablesen lässt (Maier, 2003). In dem Maße, in dem es gelingt, einen dieser Nachrichtenwerte „heraus zu präparieren“, verwandelt sich ein a priori wissenschaftliches Thema in ein journalistisches. Die genannten Nachrichtenwerte sind Selektionskriterien, d. h. ein Journalist wählt nur solche Themen aus, die seiner Meinung nach das Kriterium der Aktualität oder der Überraschung erfüllen; im Rahmen eines Fernsehinter- oder Rundfunkinterviews ist der Journalist bestrebt, diesen Nachrichtenwert deutlich werden zu lassen: Ob jedoch die Aktualität bzw. Neuigkeit eines Wissenschaftsthemas deutlich wird, hängt nicht nur vom Journalisten alleine ab; auch der Wissenschaftler selbst wirkt daran mit, ob das medial dargestellte Thema als ein journalistisch bedeutsames erkennbar wird. Wählt ein Journalist ein Thema aus (z. B. „Depression“), weil er glaubt, dass sich viele durch dieses Thema angesprochen fühlen, so hat dieses Selektionskriterium eine selbstverpflichtende Wirkung: Der Journalist wird fortan bemüht sein, den Nachrichtenwert der Relevanz einzulösen. Ob das jedoch gelingt, hängt auch vom Gesprächspartner ab, der durch seine Aussagen dieses Bemühen unterstützen („Depression ist eine Volkskrankheit“) oder konterkarieren kann („Heute werden viele Menschen für depressiv erklärt, die in Wirklichkeit gesund sind“). In der publizistischen Forschung werden die Nachrichtenwerte in erster Linie als Kriterien verstanden, entlang derer ein bestimmtes Thema ausgewählt wird (Kohring, 2003). Psychologisch gesehen, geht von diesem Selektionskriterium ein Verpflichtungscharakter aus: Der Journalist verpflichtet sich selbst darauf, den vorab erkannten „Wert“ eines Themas im Zuge des journalistischen Gestaltungsprozesses deutlich werden zu lassen. In dem Maße, in dem der Experte den Journalisten dabei unterstützt, das einmal erkannte Potenzial eines Themas offenbar werden zu lassen, erfüllt dieser die Erwartungen des Journalisten. Die Erwartung, die ein Journalist an sein Gegenüber als Interviewpartner stellt, leitet sich aus der Vor-Erwartung ab, die der Journalist einem bestimmten Thema entgegen bringt. Orientiert sich ein Journalist z. B. an dem Nachrichtenwert „Aktualität“, so ist er bestrebt, den Experten in seinem Beitrag so „einzusetzen“, dass durch dessen Aussagen die „Aktualität“ des Themas auch tatsächlich deutlich wird. Das vom Journalisten ausgemachte mediale Potenzial ist nicht immer identisch mit dem „Potenzial“, das ein Experte dem entsprechenden Thema zuschreibt. Allerdings verarbeiten und bewerten Personen (Journalisten und Rezipienten) verschiedene Themen nach denselben allgemeingültigen Kriterien, wie Eilders (1996) nachweisen konnte. Theorie 59 Das Bewerten und das Einschätzen von Sachverhalten und das explizite Schlussfolgern bzw. das Aufzeigen von Konsequenzen sind aus Sicht von Journalisten wichtige verbale Mittel zur mediengerechten Gestaltung eines wissenschaftlichen Inhaltes. Die explizite Schlussfolgerung steht dabei am Ende einer argumentativen Kette. Der Journalist erwartet von einem Experten, dass er sowohl die Prämisse offen legt, auf der seine Argumentation fußt als auch die Schlussregel benennt, mittels derer er seine Schlussfolgerung vornimmt. Der Experte neigt nach Ansicht von Bromme (2000) dazu, bestimmte Aspekte seines Fachwissens implizit vorauszusetzen: So kann es passieren, dass er die Prämisse, auf die sich seine Argumentation stützt, nicht eigens erwähnt, weil er sie für selbstverständlich bzw. für allgemein akzeptiert hält. Nach Toulmin (1996; zit. nach Bayer, 1999) lässt sich eine Argumentationskette wie folgt darstellen; auf allen Ebenen der Argumentation kann es prinzipiell zu „Missverständnissen“ kommen, weil der Experte die einzelnen Argumentationsschritte nicht ausreichend transparent macht. Abbildung 5: Argumentationsmodell nach Toulmin (1996) (zusammengestellt in Anlehnung an Bayer, 1999, S.144-145) Argument (Daten, „datum“) deshalb, Operator, („qualifier“) wegen Schlussregel („warrant“) Schlussfolgerung (These, „conclusion“) wenn nicht Ausnahmebedingung („rebuttal“)l aufgrund von Stützung („backing“) Die Explikation der einzelnen Teilaspekte einer Argumentation resp. einer Spitzenformulierung wird von Journalisten in unterschiedlich starkem Maßen erwartet; in Abhängigkeit davon, ob es sich um ein Statement- oder ein Recherche- Interview handelt (Haller, 1991), spielt die ausführliche Darlegung der einzelnen argumentativen „Schritte“ eine unterschiedlich große Rolle: Je kürzer ein Interview und je stärker es als Statement- Interview konzipiert ist, desto weniger ist es möglich, die Prämissen, Schlussregeln und Ausnahmebedingungen einer postulierten These ausdrücklich zu nennen. Neben der Begründung der Spitzenformulierung bzw. Hauptthese erwartet der Theorie 60 Journalist von einem Wissenschaftler, dass er einen komplexen Sachverhalt zu vereinfachen versteht bzw. dass er einen Sachverhalt auf seine „Quintessenz“ zu reduzieren vermag. Dies setzt auf Seiten des Wissenschaftlers die Bereitschaft voraus, die Komplexität eines wissenschaftlichen Tatbestandes reduzieren zu wollen. Die Bereitschaft bzw. Fähigkeit, einen Sachverhalt durch Selektion und Gewichtung bestimmter Informationen zu vereinfachen, wird im Rahmen dieser Arbeit als Kondensieren bezeichnet. Indem der Wissenschaftler ein Kondensat bildet, vereinfacht er ein bestimmtes wissenschaftliches Phänomen auf die seines Erachtens wesentlichen Aspekte. Journalisten nehmen ein bestimmtes Forschungsergebnis häufig zum Anlass, um das damit verbundene Themenfeld aufzubereiten. Der eigentliche journalistische Anlass (etwa eine neue Studie über die psychischen Folgen der Arbeitslosigkeit) dient lediglich als Aufhänger; ausgehend von einem solchen Aufhänger, zielt der Journalist darauf ab, das Thema zu „weiten“ (z. B. Zukunft der Arbeitsgesellschaft). Experten, die von Journalisten befragt werden, müssen darauf gefasst sein, über den spezifischen Bereich ihrer eigenen Forschungstätigkeit hinaus befragt zu werden. Dadurch verändert sich ihre Rolle: Sie werden nicht mehr nur als Forscher zu einer eng umgrenzten Thematik befragt, sondern müssen sich als Experte zu einem breiter gefassten Themenfeld äußern. Um diesen medialen Ansprüchen gerecht werden zu können, muss der Wissenschaftler über so genanntes Überblickswissen verfügen, d.h. er muss imstande sein, ein Wissensthema vor dem Hintergrund aktueller und historischer Forschungsbefunde zu bewerten. Indem der Wissenschaftler auf Studien verweist, die er nicht selbst zu verantworten hat [1] und indem er die Entwicklung eines Forschungsfeldes durch faktenbasierte Argumente erläutert [2], beweist er das von Journalisten so häufig geforderte Überblickswissen. Die inhaltliche „Stützung“ der dargelegten Argumente bzw. Statements kann nach Bayer (1999) auf unterschiedliche Weise erfolgen. Im Rahmen eines Fernsehinterviews wird der Journalist die „Schwächen“ des jeweiligen Argumentationstyps aufzudecken versuchen. Von Wissenschaftlern wird in der Regel eine Fakten-Argumentation gefordert. Bei Wissenschaftlern, die aufgefordert sind, aus ihrer beruflichen oder wissenschaftlichen Praxis zu berichten, spielen erfahrungsbasierte Argumente eine große Rolle. Geht es v. a. darum, ein Thema laiengerecht zu vermitteln, so ist der Einsatz von Analogie- Argumente besonders indiziert. Theorie 61 Tabelle 11: Typen von Argumenten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile (zusammengestellt in Anlehnung an Bayer, 1999, S.134-135) Art des Arguments Voraussetzungen für die Überzeugungskraft des Arguments Schwächen des Arguments Anerkennung der Kompetenz der zitierten Autorität Meinungsunterschiede gleich wichtiger Autoritäten in einer bestimmten Frage Anerkennung der allgemeinen Verbindlichkeit und Anwendbarkeit von Normen Wertekonkurrenz in der pluralistischen Gesellschaft bzw. in der pluralistischen Psychologie Fakten Sich- Stützen auf Forschungsergebnisse und Statistiken Nachprüfbarkeit Konkurrierende Forschungsergebnisse (v. a. in den Sozialwissenschaften) Erfahrung / Beobachtung Sich- Stützen auf eigene (professionelle) Erfahrungen Generalisierbarkeit Unterschiedliche oder fehlende Erfahrungen Geringe Verallgemeinerbarkeit Vergleichbarkeit Scheinvergleich („hinkender Vergleich“) Logische Unbestreitbarkeit Scheinlogik (Syllogismus) Autorität Sich- Stützen auf Autoritäten Normen Sich- Stützen auf in der Gesellschaft herrschende Wertvorstellungen und Gesetze Analogie Sich- Stützen auf gleichartige Vorgänge Logik Sich- Stützen auf "Gesetze" des Denkens (z. B. Kausalität) Wissenschaftler verfügen über bestimmte wissenschaftsgeleitete Techniken, durch die sich ihr Handeln in der Forschung und in der Praxis legitimiert. Journalisten erwarten von Wissenschaftern, dass sie ihre professionellen Techniken offen legen bzw. transparent machen. Diese Erwartung bezieht sich sowohl auf das methodische Vorgehen bei der Planung und Umsetzung eines Forschungsvorhabens als auch auf die praktischen Handlungsanleitungen, die ein Wissenschaftler auf der Grundlage seiner gewonnenen Erkenntnisse erteilt. Der von einer wissenschaftsgeleiteten Profession erhobene Machtanspruch muss aus Sicht der Medien erstritten werden: Das „Wie“ ihres Handelns offen legend, lösen Wissenschaftler den (implizit) erhobenen Selbstanspruch ein, in bestimmten Feldern besonders handlungsbefugt zu sein. Das Offenlegen bzw. Transparent- Machen setzt auf Seiten der Wissenschaftler ein egalitärdemokratisiertes Selbstverständnis voraus: Der sich medial äußernde Wissenschaftler muss bereit sein, der Öffentlichkeit auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und sich unprätentiös als Teilnehmer an einem Problemlösungsprozess zu begreifen (Peters & Göpfert, 1995). So wie ein Experte im Theorie 62 medialen Kontext verpflichtet ist, einen wissenschaftlichen Tatbestand zu simplifizieren, so ist er gleichfalls dazu aufgefordert, einen in der Regel abstrakten Sachverhalt mittels geeigneter sprachlich-stilistischer Techniken zu konkretisieren. Tabelle 12: Sprachlich-stilistische „Techniken“ zur Konkretisierung eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Metapher Innovative Metaphern Populäre Metaphern Analogie Analogie zwischen wissenschaftlichem Phänomen und Alltag Analogie zwischen zwei disjunkten Wissenschaftssphären (z.B. Biologie und Psychologie) Beispiel Fallgeschichte Prototypische Beispiele („Musterfälle“) „Idiographisch“ Fallgeschichten Durch Metaphern, Beispiele und Analogien ist es möglich, einen Sachverhalt zu konkretisieren. Bei der Beschreibung von Störungsbildern oder innerpsychischen Prozessen gelten beispielhafte Fallschilderungen als besonders probates Mittel; die gewählten Beispiele sollten nach Möglichkeit prototypisch sein, d.h. einen „Erfahrungswert“ transportieren, der über den geschilderten Einzelfall hinaus geht. Allerdings dürfen Fallbeispiele nicht zu schematisch bzw. konstruiert ausfallen. Die Forderung nach einem zugleich prototypischen und „idiographischen“ Fallbeispiel ist nicht so ohne weiteres einlösbar. Durch den Einsatz von Metaphern und Analogien soll es gelingen, einen abstrakten, der Wahrnehmung entzogenen bzw. schwer zugänglichen Wirklichkeitsausschnitt in die Erfahrungswelt des Rezipienten zu übertragen. Bei der Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte sind Metaphern von zentraler Bedeutung, sie prägen den Diskus zwischen Laien und Experten. Journalisten erwarten von Wissenschaftlern, dass sie ihre Inhalte anhand von Metaphern oder Beispielen zu erläutern versuchen (Göpfert, 1996). Dabei dient die bildhafte Sprache nicht nur dem Zweck des Verständlichmachens eines Themas, darüber hinaus soll ein wissenschaftlicher Topos „beseelt“ bzw. mit einer Erlebnisqualität ausgestattet werden, die ihm per se nicht eigen ist. In neuzeitlichen Theorien wird die Metapher als Ergebnis einer Sprachhandlung gesehen (Searle, 1982), die auf einen kreativen Kognitionsprozess zurückgeht (Lakoff & Johnson, 1980). Kaum eine Wissenschaft ist so stark wie die Psychologie darauf angewiesen, ihren Forschungsgegenstand durch metaphorische Umschreibungen und beispielhafte Fallschilderungen verständlich zu machen. Am Beispiel eines Artikels aus der Wochenzeitung „Die Zeit“ zum Thema „De- Theorie 63 pression“ soll dieses Phänomen kurz verdeutlicht werden25. Depression wird in dem Artikel metaphorisch als ein Erstarren des Ichs („Wenn das Ich erstarrt“) definiert; hierdurch wird die Störung in das semantische Feld „Winter“ bzw. „Kälte“ eingegliedert. Der innerpsychische Ablauf, der sich in einer depressiven Person zuträgt, wird durch eine Analogie bzw. durch einen Vergleich zu erklären versucht; auf diese Weise soll ein von außen nicht wahrnehmbarer Vorgang sichtbar und anschaulich gemacht werden. In dem Artikel heißt es: Oft beginnt das Leiden mit dem Gefühl als sei die Welt ein Stück abgerückt, als sei man, ohne Vorwarnung, von den anderen durch Glas getrennt. Jeden Tag wird es dicker, bis jedes freundliche Wort, jede liebevolle Geste außen daran abprallt. Drinnen, allein, wächst die Verzweiflung, die Panik, sie saugt einen aus. Die Störung „Depression“ wird anhand eines „Fallbeispieles“ erklärt; die depressive Person, deren Gefühlsleben in dem Artikel metaphorisierend als „starr wie Backstein“ bezeichnet wird, unterzieht sich einer so genannten „Elektroschock- Therapie“, die als letztes Mittel der Wahl dargestellt wird. Die Beschreibung der depressiven Patientin bleibt blass und schemenhaft: Sie ist mittelgroß, mittel alt, mit einem mädchenhaften Pferdeschwanz, und ihr Händedruck ist wehrlos wie der eines Kindes. Aus eigener Kraft tritt sie ins Behandlungszimmer der Münchner Klinik, doch das sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass ihr Zustand lebensbedrohlich ist. So spektakulär sich das therapeutische Verfahren ausnimmt, das in dem Artikel beschrieben wird, so gewöhnlich fällt im Gegensatz dazu die Schilderung der Patientin aus, die diese Behandlungsmethode für sich in Anspruch nimmt. Die „Elektroschock-Therapie“ wird als eine mögliche Behandlung geschildert, wobei es kein Zufall sein dürfte, dass sich Ute Eberle, die Autorin des Artikels, just für dieses Beispiel entschieden hat, um den „Kampf“ der Medizin bzw. Psychologie gegen die „Volkskrankheit“ Depression zu illustrieren. Die Behandlungsmethode „Elektroschock“ ist spektakulär, sie ruft visuelle Assoziationen hervor und sie lässt sich gut anhand von Bildern veranschaulichen. Apathisch starrt sie an die Decke, während ihr die Psychiaterin Elektroden auf Brust, Arm und Stirn klebt. Neun kleine rote, um Herzschlag, Gehirnschwingungen und Muskelregungen zu messen, zwei große weiße für den Strom. Man stelle sich nur einmal versuchsweise vor, die Behandelbarkeit der Störung müsste am Beispiel einer Gesprächspsychotherapie verdeutlicht werden: Ein solches Behandlungsbeispiel würde nicht dabei helfen, den ohnehin schwer fassbaren Sachverhalt (Depression) anschaulich werden 25 In diesem Fall werden die Metaphorisierungen von der Journalistin Eberle (2004) vorgenommen. Häufig ist es jedoch auch so, dass Wissenschaftler metaphorische Umschreibungen anbieten (zum Beispiel in einem Artikel „Der inneren Hölle entkommen“ aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung). Depression wird in diesem Artikel als „Wundbrand“ und „Hölle“ bezeichnet. Theorie 64 zu lassen. Es scheint als wäre es umso notwendiger, die Behandlung einer psychischen Störung aus einem instrumentell- technischen Blickwinkel heraus zu beschreiben, je stärker sich die betreffende Störung einer direkten Beobachtung entzieht. Indem die Störung anhand der Elektroschock- Therapie beschrieben wird, gelingt es der Autorin buchstäblich, das Unsichtbare sichtbar zu machen: Strom fließt durch die Schädeldecke in die Windungen des Hirns, dessen Nervenzellen feuern, und die Muskeln am ganzen Körper beginnen krampfhaft zu zucken. (...) Das EEG-Gerät beginnt dissonant zu heulen, ein Zeichen, dass das Gehirn wie gewünscht krampft. Der Papierausdruck wird später zeigen, dass das EEG rund 40 Sekunden lang wild tanzte... Das geschilderte Fallbeispiel (Elektroschock- Therapie an einer Patientin) wurde nicht nach wissenschaftlichen, sondern nach journalistischen Kriterien ausgesucht: Ein Wissenschaftler würde voraussichtlich dasjenige Verfahren schildern, das am effektivsten wirkt oder das am häufigsten eingesetzt wird; ein Journalist wählt indes ein Verfahren aus, das sich gut in Bilder übersetzen und eindrücklich schildern lässt. Durch die Auswahl des Beispiels wird zugleich ein bestimmtes Krankheitsverständnis vermittelt. In diesem Fall wird die Störung Depression als körperliches Gebrechen dargestellt, das sich mittels technischer Verfahren behandeln lässt. De facto wird auf diese Weise die Grenze zwischen psychischer und physischer Erkrankung negiert. Das Phänomen „Depression“ wird denn auch ausschließlich der Profession „Medizin“ zugeordnet. So kann man es fast als folgerichtig ansehen, dass an keiner Stelle des Textes das Wort „Psychologie“ oder „Psychologe“ vorkommt. In dem Artikel tauchen zahlreiche Metaphern auf; so wird etwa davon gesprochen, dass die Patienten ein Spielball ihrer Hormone seien und dass die Krankheit Depression früher als „schwarze Galle“ bezeichnet wurde. Diese historisch überlieferte Metapher („schwarze Galle“) macht deutlich, wie stark die Wissenschaft Psychologie metaphorisch war – und es auch heute noch ist. Die kognitive Funktion von Metaphern in der Wissenschaft wurde in zahlreichen Untersuchungen analysiert (Kittay, 1987; Radman, 1992). Nach Ansicht von Soyland (1994) und von Leary (1990) ist die Wissenschaft Psychologie sehr stark von metaphorischen Begriffen und Konzepten geprägt. Je stärker sich eine Wissenschaft darum bemüht, über sinnlich nicht erfahrbare Bereiche Aussagen zu machen, desto relevanter wird die Bedeutung von Metaphern als „Verständnis- und Verständigungsbrücke“. Jene Wissenschaften, wie etwa die Psychologie oder in manchen Bereichen auch die Physik, deren Erforschungsobjekte (Psychische Prozesse oder Elementarteilchen) nicht in Augenschein genommen werden können, sind stärker als andere Wissenschaften auf Metaphern angewiesen26. Für die Psychologie gilt darüber hinaus, dass sie sich der Metaphern nicht nur bei der Vermittlung ihrer Erkenntnisse bedient, sondern sogar ihrem Wesen nach metaphorisch ist. Psychologie26 Da sich die modernen Wissenschaften immer stärker von der mit dem Auge beobachtbaren Ebene wegbewegen, dürfte die Bedeutung der Metapher als Kommunikationsmittel gestiegen sein. Theorie 65 Experten verwenden sowohl im innerwissenschaftlichen Diskurs als auch im Diskurs mit der Öffentlichkeit eine Vielzahl von Metaphern und Vergleiche (z. B. „apokalyptischer Reiter“, „Beziehungskonto“)27. In Metaphern wird ein Wirklichkeitsausschnitt summarisch erfasst und dadurch auf seine – im besten Fall essentiellen, im schlechtesten Fall akzidentiellen – Aspekte reduziert (Boyd, 1979). Dies ist die an allen Metaphern im wissenschaftlichen Diskurs (sei es von Experten zu Experten, sei es von Experten zu Laien) nachweisbare übergeordnete Funktion. Davon ausgehend lassen sich weitere Funktionen angeben, die lediglich bei bestimmten Typen von Metaphern nachgewiesen werden können. Während exegetische Metaphern im pädagogisch-didaktischen Bereich (oder allgemeiner: im Bereich der Wissensvermittlung) zur Erklärung von bereits anerkannten, buchstäblich ausformulierten Theorien herangezogen werden, leiten theoriekonstitutive Metaphern einen paradigmatischen Wechsel innerhalb eines Expertendialoges ein (Boyd, 1979). Die didaktische Funktion der exegetischen Metapher ist von Caroll & Mack (1985) nachgewiesen worden. Ihren Experimenten zufolge taugen in didaktischer Absicht eingesetzte Metaphern dazu, den kognitiven Lernprozess zu stimulieren. Die Funktion der theoriekonstitutiven Metapher ist eine emphatisch-innovative: Metaphern in Theorien sind nicht-substituierbar – zumindest nicht im Rahmen bestimmter zeitlicher Grenzen. Ein sehr prominentes Beispiel für eine ursprünglich emphatisch-innovative Metapher ist die Computer-Metapher in der Psychologie. Sie wurde auf eine Vielzahl kognitiver Prozesse angewendet, wie die Begriffe Lang -und Kurzzeitspeicher, Informationsverarbeitung, zentrale Verarbeitungseinheit belegen (für eine genauere Analyse der kognitionspsychologischen Metaphorik s. Kolers & Roediger, 1984). Durch die häufige Verwendung im wissenschaftlichen Diskurs dürften diese Metaphern überstrapaziert worden sein – und folglich ihre konstitutive Rolle eingebüßt haben. Die Anwendung der Computer-Metapher auf beinah beliebig viele psychische Bereiche (Gehirn, Gedächtnis) lässt die Metapher als solche beliebig erscheinen (West & Travis, 1991). Mit Berggren (1963) und Bühl (1984, S.134ff.) lassen sich zwei Typen von Erklärungsmodellen unterscheiden, die ihrerseits mit verschiedenen Metaphern-Typen korrespondieren. Das Skalare Modell (1) fußt auf einer ikonischen Beziehung zum Gegenstand. Dieser wird teilidentisch und in proportionaler Ähnlichkeit dargestellt. Landkarten oder verkleinernde Abbildungen (einer Stadt, eines technischen Geräts) sind Beispiele für skalare Modelle. Metaphern des Vergleichs weisen ähnliche Eigenschaften wie skalare Modelle auf. Das skalare Modell „Landkarte“ hat Eingang gefunden in die Psychologie, die häufig von „kognitiven Landkarten“ spricht. Damit ist die geistige (d.h. kognitive) Organisation eines Wirklich27 Das kommunikative Problem solcher Ausdrücke besteht darin, dass sie sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch über die Grenzen der Wissenschaft hinaus einsetzbar erscheinen. Der fachsprachliche Charakter dieser Metaphern erschließt sich nicht von selbst. Die Metapher „Beziehungskonto“ verwendet Teilnehmer W2 in seinen beiden Interviews im Rahmen des hier vorzustellenden Trainings. In der Metapher „Beziehungskonto“ findet sich das Psychologische und das Ökonomische kurz geschlossen. Theorie 66 keitsausschnittes gemeint. In einer kognitiven Landkarte lassen sich die Entfernungen zwischen Begriffen ebenso abbilden wie emotionale Entfernungen zwischen Menschen. Das Soziogramm, das letztgenanntes versucht, geht auf das skalare Modell der Landkarte zurück. Das Beispiel zeigt, wie aus einem skalaren Modell mit physikalisch- geographischem Anwendungsbezug (Landkarte) ein metaphorischer Begriff abgeleitet wurde (kognitive Landkarte), der die Modellvorstellung einer Wissenschaft zu explizieren half (nämlich die Vorstellung der Psychologie, dass sich z.B. unser Wissen mit dem Modell einer Landkarte abbilden lässt. Das Analoge Modell (2) stellt seinen Gegenstand über eine strukturelle Isomorphie dar. Dabei werden Struktureigenschaften eines Bereichs auf einen anderen übertragen. Von einer solchen Analogiebildung kann z. B. gesprochen werden, wenn das marktwirtschaftliche System als eines beschrieben wird, in dem nur der Stärkste überlebt; durch Analogieschluss wird der Bereich der Biologie (Tierreich) mit dem Bereich der Ökonomie (Wirtschaftsleben) kurz geschlossen. Dieses Beispiel zeigt auch, wie schwer es im Einzelfall ist Metapher und Analogie voneinander abzugrenzen. Metaphern sind nicht wörtlich zu nehmen; sie machen eine „Als- ob- Aussage“ über die Wirklichkeit. Je usueller die Bedeutung allerdings wird, desto mehr verblasst die „Als- ob“ - Funktion der Metapher: Der übertragen gemeinte Sinn wird buchstäblich genommen. Bei vielen psychologischen Begriffen gerät der metaphorische Charakter in Vergessenheit. Metaphorische Anschauungen (wie die Strings in der Physik oder die Es-Instanz in der Psychologie) werden dann reale Qualitäten zugesprochen: Sie werden substantiiert. Das Anschauungsdefizit (etwa auf dem Gebiet der Physik oder Psychologie) wird kompensiert, indem die Metapher ein nicht beobachtbares Phänomen (Quark) mit einem beobachtbaren Phänomen verknüpft. Metaphern sind Vergleich ohne „wie“, weshalb sich eine Metapher auch immer in einen Vergleich umformulieren lässt, etwa „T-Zellen verhalten sich wie ein Detektiv in unserem Körper“. Die Wissenschaft Psychologie verfügt über zahlreiche Metaphern, die sowohl innerhalb einer Experten-Experten-Kommunikation als auch innerhalb einer Experten-Laien-Kommunikation von Bedeutung sind. Bei der Experten-Laien-Kommunikation ist es indes wichtig, den impliziten Bedeutungsgehalt der Metapher zu explizieren. Insbesondere dann, wenn die Metapher „theoriehaltig“ ist. Bei der mediengerechten Vermittlung eines Wissenschaftsthemas bedienen sich Experten und Journalisten bestimmter semantischer Felder wie z.B. Krieg, Maschine oder (Wett-) Kampf. Theorie 67 Tabelle 13: Überblick über einige metaphorische Begriffe zur Beschreibung eines wissenschaftlichen und eines psychologischen Sachverhaltes Metaphern aus der Wissenschaft allgemein28 Metaphern aus der Psychologie Kamikazekämpfer Apokalyptischer Reiter Munition der Antikörper Beziehungskonto Detektiv der Zellen Geistige Landkarte Biologisches Wettrüsten Spielball der Hormone Kompass der Seele Erstarrung des Ichs Wettrennen der Spermien Geschmack der Quarks Journalisten fordern Wissenschaftler dazu auf, Metaphern zu verwenden; neben Fallgeschichten, Beispielen und Vergleichen dienen Metaphern dazu, einen Gegenstand zu konkretisieren. Darüber hinaus erwarten sie von Wissenschaftlern noch ein zweites: Geht es nach den Journalisten, so sollen Wissenschaftler den Neuigkeitswert resp. die Originalität eines Themas bzw. einer bestimmten wissenschaftlichen These heraus zu stellen. Das explizite Herausstellen der Eigenständigkeit bzw. der Besonderheit eines Forschungsbefundes ist Wissenschaftlern in der Regel nicht geläufig: Sie sind es gewohnt, den eigenen Forschungsbefund in einen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen und ihn nicht eigens herauszustreichen. So ist es in wissenschaftlichen Publikationen keinesfalls üblich, die eigenen Forschungsergebnisse an den Anfang zu stellen – und die Vorleistung anderer Forscher geflissentlich zu ignorieren. Genau das aber wird von Wissenschaftlern, die sich medial äußern, häufig gefordert: Sie sollen das eigene Forschungsergebnis als Neuigkeit „verkaufen“, möglichst unter Ausblendung der wissenschaftlichen Vorarbeiten, auf denen die eigene Leistung fußt29. Während es innerhalb einer Wissenschaftsgemeinschaft üblich ist, die eigene Forschungsleistung als Ergebnis eines kontinuierlichen, quasi- gemeinschaftlichen Prozesses darzu- 28 Bei der Zusammenstellung dieser Liste diente ein Aufsatz von Göpfert (1997) als Anregung. Der Autor dieser Arbeit durfte im Herbst 2003 einem von Prof. W. Göpfert geleiteten Medientraining am Forschungszentrum Jülich beiwohnen. Dabei ließ sich feststellen, dass es einen hohen didaktischen Wert für Trainingsteilnehmer hatte, wenn sie gezeigt bekamen, wie ein journalistischer Artikel im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Paper aufgebaut ist. 29 Theorie 68 stellen, neigen Journalisten dazu, ein Forschungsergebnis zu personalisieren (1) und es als Bruch bzw. Umkehr von einer bis dato üblichen Sichtweise zu stilisieren (2)30. Bredemeier (1991) folgend, gibt es verschiedene Techniken, mit denen ein (auf das eigene Forschungsergebnis bezogene) Statement formuliert werden kann. Dabei lassen sich zwei grundsätzlich verschiedene unterscheiden31: Während der eine Statement-Typ darauf abzielt, die eigene Position mit einer Fremdposition zu harmonisieren, ist der andere Statement-Typ darauf ausgerichtet, einen Kontrast zwischen zwei Positionen heraus zu stellen. Es lassen sich zwei verschiedene Formen der Kontrastbildung differenzieren: Zum einen der Kontrast zwischen eigener Position und Fremdposition und zum andern der Kontrast zwischen „alter“ und „neuer“ Position. Wird die eigene Position von einer Fremdposition abgegrenzt, so wird dadurch ein fachlicher Dissens nach außen dargestellt. Im Zusammenhang mit dem therapeutischen Schulenstreit ist eine solche argumentative Vorgehensweise häufig zu beobachten (s. etwa den Artikel „Der Graben ist größer denn je“ im Tagesspiegel vom 20. August 2004)32. Wird die „neue“ (moderne) Position von einer „alten“ Position abgegrenzt, dann wird dadurch der wissenschaftliche Fortschritt illustriert. Argumentative Techniken der Kontrastierung werden von Journalisten insofern gewünscht als dass sich dadurch die „Neuigkeit“ bzw. „Originalität“ einer bestimmten Position verdeutlichen lässt. Durch die Darstellung eines inhaltlichen Kontrastes oder Bruches wird es möglich, den Nachrichtenwert eines Themas kenntlich zu machen. Wie deutlich wurde, existiert eine Vielzahl von Erwartungen, mit denen Journalisten an Wissenschaftler heran treten; diese „Erwartungen“ sind weder den Wissenschaftlern noch den Journalisten zu jeder Zeit bewusst. Insbesondere Wissenschaftlern gebricht es häufig an einer realistischen Vorstellung darüber, was die Medien (bzw. die Medienvertreter) von ihnen wünschen bzw. erwarten. 30 Journalisten arbeiten dramaturgisch; die Forderung nach einem „Bruch“ ist vergleichbar mit dem „Peripetie“ - Konzept in Filmen (s. Buchholz & Schult, 2000). 31 Ähnliche Konstruktionsprinzipien spielen bei meinungsbildenden Darstellungsformen (etwa beim Kommentar) eine Rolle (antithetischer Aufbau; synthetischer Aufbau). 32 Die Einheit der Profession Psychotherapie wird von den Medien unterschiedlich wahrgenommen; in dem o. g. FAS- Artikel wird der Eindruck erzeugt, als würden unterschiedliche „Spezialisten“ der Seele unideologisch zusammen arbeiten. Theorie 69 Tabelle 14: Inhaltliche Erwartungen von (Wissenschafts-)Journalisten an Expertinnen und Experten • Wissenschaftliche Leistung soll im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit, ihren Nutzen, ihr (zukünftiges) Potenzial bewertet werden • Experte soll die Rolle des „Lehrers“ bzw. des Aufklärers tradieren • Aufzeigen von real-praktischen, individuellen und gesellschaftlich- politischen Konsequenzen, die sich aus einem Forschungsbefund, einer wissenschaftliche fundierten Behandlung, etc. ergeben • „Weitung“ des Themas über die eigene spezifische Forschungsfrage hinaus • Thema soll auf diese Weise an Relevanz gewinnen • Wechsel von der Rolle des „Forschers“ zur Rolle des „Experten“ • Methodische Vorgehensweisen sollen offen gelegt werden • Praktische Handlungsweisen (etwa im Rahmen einer therapeutischen Intervention) sollen transparent gemacht werden • Experte ist aufgefordert, sein „elitäres“ Selbstverständnis aufzugeben Bewerten bzw. Einschätzen eines wissenschaftlichen Sachverhaltes Aufzeigen von Konsequenzen, die sich aus einem wissenschaftlichen Tatbestand ergeben Absichern der eigenen Argumente mithilfe von Überblickswissen Offenlegen des praktischen und beruflichen Vorgehens Theorie 70 Herausstellen eines Konfliktes oder Gegen- • satzes, der zwischen der eigenen Position und einer Fremdposition besteht • Die eigene Position sollte klar heraus gestellt werden Vereinfachen eines komplexen Sachverhaltes • Ein komplexer Sachverhalt sollte durch Gewichtung und Selektion vereinfacht werden • Reduktion eines Sachverhaltes auf die (vermeintlich) wesentlichen Aspekte (Prioritätensetzung) • Ein abstrakter Sachverhalt sollte nach Möglichkeit konkretisiert werden, um dem Rezipienten eine Identifikation zu ermöglichen • Ein abstrakter Sachverhalt sollte mit Hilfe von Metaphern, Analogie oder Beispielen veranschaulicht und konkretisiert werden • Die Prämisse und die Schlussregel einer Argumentation sollen expliziert werden • Stützende Argumente und Einschränkungen sollen deutlich heraus gestellt werden • Der „Geltungsbereich“ der aufgestellten These sollte benannt werden Konkretisieren eines abstrakten Sachverhaltes Aufzeigen der einzelnen argumentativen „Schritte“, auf die sich die behauptete wissenschaftliche These stützt Die Originalität bzw. Eigenständigkeit der eigenen Forschungsleistung sollte deutlich werden