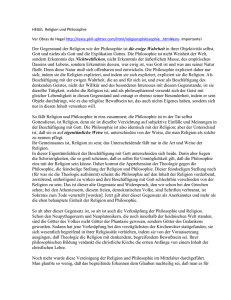sche Perspektiven (2003), S. 112
Werbung

In: Widerspruch Nr. 39 Kritik der Globalisierung - außereuropäische Perspektiven (2003), S. 112-132 Neuerscheinungen Besprechungen Neuerscheinungen Pierre Bourdieu Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft Aus dem Französischen von Achim Russer unter Mitwirkung von Hélène Albagnac und Bernd Schwibs, Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp), geb., 335 S, 19.50 EUR. Ein soziologischer Selbstversuch Aus dem Französischen von Stefan Egger; Nachwort von Franz Schultheis, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), kart., 151 S., 8.50 EUR. Die Meditationen (Méditations pascaliennes, Paris 1997) behandeln Fragen, die der Autor Pierre Bourdieu (1.8.1930-23.1.2002) „lieber der Philosophie überlassen hätte“, deren Vertreterschaft im „akademischen Feld“ sich jedoch en gros weigere, konsequent beschreibend und reflektierend auf die sozialen Voraussetzungen und Bedingungen der eigenen Theorieproduktion(en) Bezug zu nehmen. Anknüpfend an seine umfangreichen Feldstudien „Die feinen Unterschiede“ und „Homo academicus“ sollen die „Meditatio- nen“ eine „Kritik (im Kantschen Sinne) der gelehrten Vernunft bis zu einem Punkt treiben, der gewöhnlich unberührt bleibt“. Der Soziologe Bourdieu fordert den Verzicht „auf die Illusion, dass das Bewusstsein sich selbst durchschaut, und auf die unter Philosophen gängige Vorstellung von Reflexivität“. „Scholastisch“ nennt er – durchaus die Epoche der Scholastik einbeziehend, aber nicht nur diese – eine „doxa“ der Voraussetzungslosigkeit, der Entbindung des eigenen, akademischen Feldes von anderen sozialen Feldern, die allererst möglich werde durch eine privilegierte Situation der „scholé“ (Muße), einer bestimmten Freiheit von ökonomischen Zwängen, die als Möglichkeitsbedingung der Illusion eines „reinen Denkens“ aufzufassen sei. „Die spezifische Logik des Feldes“, so Bourdieu, „nimmt als spezifischer Habitus Gestalt an“ und zwar „in einem gewöhnlich als (‚philosophischer’, ‚literarischer’, ‚künstlerischer’ usw.) ‚Geist’ oder ‚Sinn’ bezeichneten Sinn für das Spiel, der praktisch niemals artikuliert oder vorgeschrieben wird“. Bourdieu e- Neuerscheinungen xemplifiziert dies vor allem am Betrieb der „Königsdisziplin“ Philosophie an der Pariser École Normale Supérieure, rückblickend auf das eigene Philosophiestudium an dieser Hochschule. Als den „scholastischen Point d’honneur“ sieht er eine ausdrückliche Geringschätzung der Sozialwissenschaften, die letztlich Heidegger mit zu einem Garanten „der Würde des philosophischen Metiers“ erhoben habe. Bourdieu lehnt sich zwar an J.L. Austins Ausführungen über einen „scholastic view“ an (Sense and Sensibilia), einer „Haltung des ‚Als ob’, dem Spiel der Kinder und ihrem ‚Tun als ob’ verwandt“. Und er sieht vor allem in Wittgensteins Werk die „Zerstörung jener Illusionen, die die philosophische Tradition produziert und reproduziert“. Verschiedene Gründe legten jedoch nahe, die „Meditationen“ unter das Vorzeichen Blaise Pascals und seiner „Pensées“ zu stellen. Denn es komme darauf an, nicht nur die Grenzen des Denkens und der Macht des Denkens zu reflektieren, sondern auch die Voraussetzungen, die dazu veranlassen, „die zwangsläufig partiellen, geographisch wie sozial begrenzten“ Erfahrungen scheinbar transzendieren zu können. Pascals „Abweisung des Anspruchs, letztgültige Grundlagen zu formulieren“, und dessen Überzeugung, „dass die wahre Philosophie über die Philosophie spottet“, aber unterschlage nicht die eigene Einbindung in einen religiösen Glauben und in theologische Dispositionen. In Analogie dazu unterzieht Bourdieu seine Soziologie des Philosophiebetriebes ihrerseits einer sozio- logischen Untersuchung (Ein soziologischer Selbstversuch). In den „Meditationen“ hebt Bourdieu „drei Formen des scholastischen Irrtums“ hervor: einen „Epistemozentrismus“, einen „moralistischen Universalismus“ und einen „ästhetischen Universalismus“, die sich allesamt einer subtilen Ignoranz gegenüber den jeweiligen sozialen Bedingungen des Zuganges zu bestimmten symbolischen Formen und Praktiken verdankten. Zum zweitgenannten „Irrtum“ schreibt Bourdieu: „Allen, jedoch rein formal die Zugehörigkeit zur ‚Menschheit’ zusprechen heißt, unter humanistischem Mäntelchen alle davon auszuschließen, denen die Mittel entzogen sind, diese Zugehörigkeit wahrzunehmen“. Er bezieht diese Kritik exemplarisch auf Habermas’ „Theorie des kommunikativen Handelns“, auf das Modell einer „kommunikativen Vernunft“, dem er vorhält, „die Politik unversehens auf das Terrain der Ethik“ zurückzuholen. Mit dem universalistischen Ideal eines „vernünftigen Konsens“, dem Ideal einer Macht der Argumente, seien die Argumente der Macht ignoriert und damit die sozialen Bedingungen, überhaupt Argumente geltend machen zu können. Für Bourdieu verfügen Angehörige verschiedener sozialer Felder weniger über ein gemeinsames Ausdrucksrepertoire als dass die sozialen Felder das Wie von Expressionen prägen. Die Kritik legt dar, dass Habermas’ „scholastische Schranke“ eine konsequente Eigenbezüglichkeit verhindert, und dies um den Preis einer Universalisierung des „eigenen Falls“. Neuerscheinungen So wird auf eine „doppelte Wahrheit“ verwiesen, die den Soziologen nicht übersehen lassen sollte, „dass die Mühe um die Verdrängung und ihre mehr oder weniger phantasmatischen Ergebnisse ebenso zur Wahrheit gehören wie das, was sie zu tarnen versuchen“. Dies pointiert eine Zirkularität, der Bourdieu konsequent nachzugehen versucht. Mit ihr sieht er einen „Freiheitsspielraum“ verbunden, Idealen einer „Koinzidenz zwischen objektiven Tendenzen und persönlichen Erwartungen“ entgegentreten zu können und damit der Illusion, die Welt sei „eine lückenlose Verkettung bestätigter Antizipationen“. Bourdieu verweist auf Kafkas Josef K. und das paradoxale „Wahrheitsspiel“ im „Prozess“, einen „Standpunkt oberhalb der Standpunkte zu finden“. Nichts sei „grausamer verteilt als das symbolische Kapital, das heißt die soziale Bedeutung und die LeVor allem von Seiten einer journabensberechtigung“. listisch disponierten Kritik in Frankreich ist dem „Häretiker“ Bourdieu vorgeworfen worden, mit seiner Etikettierung ‚der’ Philosophie grob verallgemeinernd und aggressiv zu verfahren. Andererseits gibt es Zuweisungen zu Bourdieus Schriften wie ‚Soziologie der Philosophie’, ‚negative Philosophie’ und ‚Philosophie mit den Mitteln einer empirischen Soziologie’. All dies besagt wenig über Bourdieus (soziologische) Objektivierung von Subjektivierungen und die Bemühungen um eine Objektivierung einer Subjektivität jener programmatischen Objektivierung selber. In Ein soziologischer Selbstversuch geht es ausdrücklich um die besagte „Objektivierung des Subjekts der Objektivierung, des analysierenden Subjekts, kurzum: des Forschers selbst“. Der Text basiert auf dem letzten Teil der letzten Vorlesung am Pariser „Collège de France“ (28. März 2001). Der Titel der Vorlesungsreihe lautete: „Science de la science“, der des letzten Teils: „Esquisse pour une autoanalyse“. Die Texte wurden 2001 in Bourdieus eigenem Verlag in Paris veröffentlicht. Nach Bourdieus Verfügung sollte eine kürzere Fassung zuerst in der deutschsprachigen Übersetzung bei Suhrkamp erscheinen, dort für das Frühjahr 2002 unter dem Titel „Pierre Bourdieu über Pierre Bourdieu“ angekündigt. Nach seinem Tod im Januar 2002 wurde die französische Kurzfassung dann widerrechtlich im „Nouvel Observateur“ veröffentlicht, versehen mit Fehldatierungen der Entstehung und Verfälschungen, die suggerieren, Bourdieu habe den Text, dessen Entwürfe auf das Jahr 2000 zurückgehen, kurz vor seinem Tod geschrieben. Im Nachwort der jetzigen Suhrkampveröffentlichung der längeren Textfassung werden diese Vorgänge ausführlich vorgestellt und kommentiert. Diesem Selbstversuch legt Bourdieu die Verpflichtung zugrunde, „alle Merkmale zu berücksichtigen, die aus der Sicht des Soziologen erheblich, das heißt für eine soziologische Erklärung..., und nur dafür notwendig sind“. In dieser „Antiautobiographie“ schreibt er über die Diskrepanzen zwischen seiner Herkunft und den Perspektiven, die eine Aufnahme in die „École Normale Supérieure“ in Aussicht stellte. Vor allem aber seien es die Erleb- Neuerscheinungen nisse in Algerien, die Zeit des Militärdienstes während des Algerienkrieges und die der frühen Feldforschungen in der Kabylei gewesen, die eine „Konversion“ des Philosophen zum Ethnologen und Soziologen bewirkt hätten. Dabei betont er einen „gespaltenen Habitus“ in der Bearbeitung von „Gegensätzen“, die zu einem „eigenen Stil“ der empirischsoziologischen Forschung geführt hätten. So scheint der Zirkel einer Objektivierung der kontingenten Dispositionen des Forschers geschlossen. Angesichts des Anspruchs auf „Selbstreflexivität“ ist Bourdieus „Wissenschaft der Wissenschaft“ (Science de la science) jedoch schwerlich in einer Polarisierung von Soziologie und Philosophie unterzubringen, zumal dem die interdisziplinären Überschneidungen im französischen Hochschulsystem entgegenstehen. Es ist nicht überraschend, dass eine längere Textpassage auf „Ähnlichkeiten“ mit den Arbeiten Foucaults und deren Verhältnisbestimmungen von Macht- und Diskurspraktiken Bezug nimmt. Bourdieu schreibt über Verwandtschaften „im Bereich der Forschungen ebenso wie im Hinblick auf die Art des, im weiteren Sinne, politischen Handelns“. Ungeachtet einer „großen Nähe“ und „Solidarität“ blieb Foucault für Bourdieu – wie groß die Distanz innerhalb der akademischen Institution sein mochte – doch stets im philosophischen Feld gegenwärtig. Er grenzt seine eher „kollektiven Unternehmen“ gegenüber Foucaults „einsamer“ Arbeit ab, „die den Erwartungen der künstlerischen und literarischen Welt“ sehr viel mehr entgegengekommen sei. Aufschlussreich hinsichtlich der Position einer „Selbstreflexivität“ dürfte ein Vergleich mit Luhmanns systemtheoretischer Soziologie sein, vor allem mit der „Wissenschaft der Gesellschaft“ (1992). Die hier tragende Konstruktion einer Beobachtung der gesellschaftlich eingebundenen Beobachtung und Beschreibung setzt auf die stufenweise Erzeugung von Unterscheidungen von Unterscheidungshinsichten, die so als die ‚eigenen’ entparadoxiert werden sollen mit dem Ziel einer „Komplexitätsreduktion“. Demgegenüber besteht Bourdieu auf einer „Implizierung“ des Forschers selber, der habituell und von den Dispositionen her in den „sozialen Raum“ eingebunden sei. Ignaz Knips Jonathan Crary Aufmerksamkeit. Wahrnehmung und moderne Kultur Deutsch von Heinz Jatho, Frankfurt am Main 2002 (Suhrkamp), geb., 400 S., 39,90 EUR. Der amerikanische Kunsttheoretiker Jonathan Crary hat mit seiner Arbeit über “Aufmerksamkeit” das zweite Buch in Deutschland veröffentlicht. Der Untertitel darf als Programm gelten: “Wahrnehmung und Kultur” soll eine Geschichte der Wahrnehmung im 19. Jahrhundert sein. Die Aufmerksamkeit erweist sich in dieser Geschichte der Wahrnehmung als besondere Bedingung der Subjektivität der Moderne. Mit den Anforderungen des Arbeitprozesses, Neuerscheinungen der Instrumentalisierung des Menschen und den physiologischen Erkenntnissen entstehen normative Subjektivitätsmodelle, die auch in der Wahrnehmung deutliche Spuren hinterlassen. Crary stellt die Maler Édouard Manet, Georges Seurat und Paul Cezanne jeweils in den Mittelpunkt der Diskurse um die Wahrnehmung. Bilder, wie “Im Wintergarten”, “Parade de cirque” und “Kiefern und Felsen” bieten reiche Belegstellen für die Interpretation der Wahrnehmung, die zwischen 1810 und 1840 einen tiefgreifenden Bruch erfahren hat. Mit dem Ausgangsmaterial der Gesamtkultur gerät das künstlerische Subjekt als Betrachter nun unter eine Vielzahl von Einflussmöglichkeiten, die selbst den Rahmen des Hyperkomplexen zu sprengen drohen. Die Photographie bei Edward Muybridge, die Philosophie Henry Bergsons in “Materie und Gedächtnis” oder Ernst Machs Theorie der Empfindungen liefern - um nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen das breite Sortiment für die Bildinterpretation. Auf der physiologischen Seite finden die Theorien von Hermann Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, Wilhelm Wundt und Charles Scott Sherrington Berücksichtigung. Die klassische Vorstellung von Wahrnehmung wurde auf physiologischer Seite einer gründlichen Revision unterzogen, was auch in den Bildern der genannten Maler Reaktionen hervorruft. Der Kern der Argumentation zielt auf die Auflösung der Objektivität der Sinne, die in einem zerstreuten Betrachter gipfelt. Letzteres provoziert auf psychophysischer Seite die Konzentration auf Aufmerksamkeit. Die Bilder zeigen so unterschiedlich genutzte Freiräume, aber eben keine beliebigen Spielräume der Wahrnehmung. Gemessen an herkömmlicher Bildlichkeit demonstriert beispielsweise Cezanne durch seinen Entwurf, was bereits Tatsache ist: Der Wahrnehmungsraum entspricht nicht mehr den alten Sehgewohnheiten. Cezanne verfolgt nach Crary daher konsequent die Strategie einer Bilddestabilisierung, die bereits die Vorstufe jener dynamisierten Wahrnehmung erfasst, mit der sich das maschinengestützte Sehen des Kinos entfalten kann. Wenn die Arbeit hochgradig nichtlinear erscheint, und wiederholt die Züge einer patchworkartigen Sammlung von Aussagen zur Wahrnehmung im 19. Jahrhundert annimmt, kann und darf dies nicht verwundern. Die Materie bietet hier selbst wohl kaum die Kohärenz, die eine lineare Entwicklung der Gedanken erlaubt. Crary verweist außerdem immer wieder darauf, dass ihm an erzwungener Kontinuität auch nicht gelegen ist. Stattdessen handelt es sich um interessante Fallstudien, die in ihrem Facettenreichtum und durch riskante Interpretationen die Vielschichtigkeit der Wahrnehmung in assoziativer Form verdeutlichen. Michael Ruoff Michel Foucault Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Hg. von D. Defert und F. Ewald unter Mitarbeit von J. Lagrange. Aus dem Französischen von R. Ansén, M. Bischoff, H.-D. Gondek, H. Kocyba und J. Schröder. Neuerscheinungen Band 1: 1954–1969, Frankfurt/ Main 2001 (Suhrkamp), br., 1076 S., 58.- EUR. Band 2: 1970–1975, Frankfurt/ Main 2002 (Suhrkamp), br., 1032 S., 58.- EUR. Zwei voluminöse, jeweils über tausend Seiten starke Bände der insgesamt vierbändigen Schriften Michel Foucaults liegen nun vor. Sie machen erstmals in deutscher Sprache geschlossen auch jene Arbeiten – Vorträge, Artikel, Vorworte, Interviews, Diskussionsprotokolle, Flugblätter und Rezensionen – des 1984 verstorbenen und nach wie vor bedeutendsten Theoretiker der neueren französischen Philosophie zugänglich, die bislang gar nicht oder bloß in verstreuten, zum Teil vergriffenen Ausgaben zu haben waren, vom französischen Original und englischen Übersetzungen einmal abgesehen. ‚Dits et Ecrits’ ergänzt also die Ausgabe der größeren Werke, die ebenfalls bei Suhrkamp erschienen sind und parallel noch durch Vorlesungsveröffentlichungen vervollständigt werden. Es gehört zur kritischen Tradition einer engagierten Sozialphilosophie, die im französischen Sprachraum von Sartre bis Bourdieu gilt, dass gerade die kleineren Schriften den eingreifenden Gedanken nah an die Praxis herangebracht haben und oft konkreter sind, als ein systematisches Werk es vermag. Dies entspricht gerade dem speziellen oder spezifischen Intellektuellen Foucault, der seine theoretische Arbeit als einen Werkzeugkasten für soziale Bewegungen verstanden wissen wollte: das am Gegenstand orien- tierte, punktuelle, genaue Schreiben, sozusagen in den Mikrophysik der Macht eindringend. Bislang publizierte vor allem der Berliner Merve Verlag diese geradezu politischen Texte Foucaults; und nach wie vor macht es Sinn, sich die eigentümlich gelayouteten und echten Taschenbücher von Merve zuzulegen. Sie können, anders als die dicken Schriftenbände, ohne Weiteres mitgenommen werden, um so gegebenenfalls im Sinne Foucaults vor Ort dessen Philosophie zu praktizieren. Dagegen bilden die „Schriften in vier Bänden“ ein akademisches Unterfangen, an dem die editorische Aufmachung der Bände hervorzuheben ist. Im ersten Band findet sich eine knapp 100-seitige Zeittafel, die Foucaults Biografie ausführlich nachzeichnet, nebst der wichtigen historischen Ereignisse, die Foucaults Arbeit betreffen. So erfährt man, dass Foucault 1960 in Hamburg „gelegentlich Robbe-Grillet, Roland Barthes oder den damaligen König des Krimis Jean Bruce durch das Labyrinth des Vergnügungsviertels Sankt Pauli“ führte (I, 32). Man erfährt auch über Foucaults Mitarbeit in politischen Gruppen, über sein Verhältnis zur Linken und seine Mitarbeit bei der ‚Libération’, seinen Kampf gegen die Diskriminierung der Homosexualität, über Arbeitsgruppen und Projekte, seine HIVInfektion, seine Aids-Krankheit und den schmerzvollen Tod. In einem Testament von 1982 heißt es: „Tod, nicht Invalidität“ und „Keine posthume Veröffentlichung“ (I, 105). „Die vier Bände dieses Werkes versammeln – mit Ausnahme der Bücher – alle Schriften von Michel Neuerscheinungen Foucault, die in Frankreich und im Ausland erschienen sind“ (I, 9) schreiben die Herausgeber. Darunter: Die ‚Einführung’ zu Binswangers ‚Traum und Existenz’ (1954), ‚Die Hoffräulein’ (1965), ‚Dies ist keine Pfeife’ (1968), ‚Foucault antwortet Sartre’ (1968), ‚Was ist ein Autor’ (1969), der in Japan gehaltene Vortrag ‚Wahnsinn und Gesellschaft’ (1970), der geschichtsphilosophisch äußerst wichtige Text ‚Nietzsche, die Genealogie, die Historie’ (1971), das Manifest der Gruppe Gefängnisinformation (1971), ‚Der Intellektuelle und die Macht’ (1972), das Gespräch ‚Über die Volksjustiz. Eine Auseinandersetzung mit Maoisten’ (1972) und Interviews wie ‚Gefängnisse und Gefängnisrevolten’ (1973), ‚AntiRetro’ (1974) oder ‚Worüber denken die Philosophen nach?’ (1975). In der Zusammenstellung der Schriften ergibt sich das Bild des ungemein dichten, thematisch gleichwohl äußerst vielfältig angelegten Denkens Foucaults, das nur schwer einer Fakultät, geschweige denn überhaupt zuzuordnen ist: es reicht von Psychologie über Literaturwissenschaft zur Geschichtstheorie, immer durchsetzt mit der konkreten politischen Praxis eines Zeit seines Lebens unbequemen Intellektuellen. Fraglich bleibt, warum nicht doch alle Schriften in eine Werkausgabe aufgenommen wurden, die dann mit Ergänzungsbänden zu vervollständigen wäre (etwa Vorlesungsmitschriften, die als Raubdrucke kursieren). Wenigstens die Gespräche in dem von Rabinow und Dreyfus herausgegebenen Diskussionsband ‚Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik’ (1987) hät- ten Berücksichtigung finden können. – Nichtsdestotrotz: ein brauchbares, nicht nur die Foucaultforschung bereicherndes Projekt. Namen- und Sachregister sowie ein Literaturverzeichnis im vierten Band werden die Edition abrunden. Roger Behrens Susanne Lettow Die Macht der Sorge Die philosophische Artikulation von Geschlechterverhältnissen in Heideggers „Sein und Zeit“, Tübingen 2001 (edition diskord), 224 S., 16.EUR. In der römischen Cura-Fabel des Hyginus formt die weibliche „Sorge“ (Cura) den ersten Menschen aus Erde, während Jupiter ihm den Geist einhaucht. Im anschließenden Streit um die Namensgebung, an dem sich auch die Erde (Tellus) beteiligt, balanciert Saturn die Ansprüche aus: Das Geschöpf soll „homo“ heißen, weil es aus „humus“ (Erde) gemacht ist, nach seinem Tod soll Jupiter seinen Geist erhalten und die Erde den Körper. Die „Sorge“ aber soll das Geschöpf besitzen, solange es lebt: Sich „sorgend“ soll es sich selbst immer schon vorauseilen. Wenn Heidegger sich in Sein und Zeit auf den römischen Schöpfungsmythos bezieht – anstatt auf den biblischen –, verwirft er nicht nur den emanzipatorischen Anspruch des biblischen Glaubens an die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, er bricht auch mit dem Phantasma der Allmacht, das diesem Mythos gleichfalls innewohnt und auch die cartesianische Subjektivität be- Neuerscheinungen stimmt. Denn „sorgend“ sich voraus sein, von der „Sorge“ „festgehalten“ und „durchherrscht“ werden, bedeutet in der heideggerschen Lesart, zeitlebens unter einer Verfehlung stehen. Gottgleich soll der Mensch zwar sein eigener Ursprung sein, doch zugleich ist ihm dies in kafkaesker Weise verwehrt: Das „Selbst, das als solches den Grund seiner selbst zu legen hat“, kann „dessen nie mächtig werden und hat doch existierend das Grundsein zu übernehmen“ (Heidegger, zit.n. 75). Subjektivitätsmodelle dieser Art, die rational durchsichtige, an einer festen Entität orientierte Entwürfe anti-essentialistisch auflösen, haben Heidegger für feministische Theoriekonzeptionen und deren Suche nach einer Subjektivität, jenseits der patriarchial dominierten, interessant gemacht; für einige Autorinnen antizipiert Heidegger sogar zentrale Themen feministischer Philosophie. Susanne Lettow kann nun nachweisen, dass zu derartiger Euphorie kein Anlass besteht. Sie gibt im Gegenteil zu bedenken, dass der von Heidegger kritisierte tradierte Körper-Geist-Dualismus die ihm implizite Männlichkeit keinesfalls auflöse, sondern in eine neue Form „hegemonialer Männlichkeit“ überführe. Lettow ordnet dies historisch in die gesellschaftliche Situation der Weimarer Republik ein, wo sich Modernisierer und Konservative verschiedenster Schattierungen ideologisch rüsten, um Frauenemanziption und fordistischer Modernisierung zu trotzen. Auch in Sein und Zeit werden „Geschlechterverhältnisse“ – wie in der bisherigen philosophischen Tradition zumeist üblich – nur indirekt, entnannt (vgl. 101f), thematisiert und können, wie Lettow auf Foucault bezugnehmend schreibt, nur aus der „Beschreibung der ‚diskursiven Fakten‘“ (13) rekonstruiert werden. Hierzu bedient sich Lettow einer Theorie ideologischer Subjektion, die aus dem von Wolfgang F. Haug begründeten Projekt Ideologie–Theorie hervorgegangen ist. In einer daran anschliessenden, in sich konsistenten Lektüre kann sie zeigen, wie Heideggers „ursprungsmythische Erzählung“ (90) von einer Subjektwerdung handelt, bei der sich die „Sorge als eine Konstruktion von Mütterlichkeit" erweist, als eine „Ursprungsmacht“, in deren „Schatten sich ein autoritäres (männliches) Subjekt formiert“ (73), in dem es sich ihr unterwirft. Dieses Kernstück der Arbeit wird von verschiedenen philosophietheoretischen Überlegungen flankiert. Von einer „‚Verjenseitigung‘ neuen Typs“ (34) ist die Rede oder mit Bourdieu von einer „konservativen Revolution in der Philosophie“ (22), und in der avanciertesten These begegnen sich Heidegger und Marx auf Augenhöhe. Denn Lettow versteht die im „sich Sorgen“ gegebene Tätigkeit, die Handlung also, mit der sich das Subjekt der „Sorge“ unterwirft, als eine Art „praxeologische“ (110) Antwort Heideggers auf den theoretischen „Bruch“ (43), den Marx in seiner Wendung zum „wirklich tätigen Menschen“ (Marx, zit.n. 56) mit der Bewusstseinsphilosophie vollzogen hat. Gegenüber der marxschen Vorgabe wird „Praxis“ in der heideggerschen Version Neuerscheinungen des „sich Sorgens“ jedoch „nicht mehr in ihrer Genese aus sozialer Praxis begreifbar(..)“, sondern nur als „omnihistorisch angesetzte(.) ‚wesenhafte(.) Grundstruktur‘“, die sozusagen allem „Dasein“ immanent ist. Diese Ausrichtung wird von Lettow als „die Operation“ interpretiert, „mit der Heidegger in Sein und Zeit die theoretische Revolution der Feuerbach-Thesen bändigt“ (48, vgl. 109ff). Für die Perspektive, aus der diese Arbeit verfasst ist, kommt der Verknüpfung Heideggers mit Marx eminente Bedeutung zu. Denn mit der Rede von der „omnihistorisch angesetzten ‚wesenhaften Grundstruktur‘“ verweist Lettow auf den Heidegger- und Lacan-Rezipienten Althusser, der wiederum den Gedanken der Omnihistorizität – für ihn das Merkmal von Ideologie schlechthin – an das „Unbewußte“ Freuds angelehnt hatte. Im „Sorgen“ ist Heideggers „In-der-WeltSein“ somit gewissermaßen zur Reinform althusserscher Ideologiezität geronnen, an der Lettow auch ihre kritische Analyse des heideggerschen Entwurf einer neuen patriarchalen Subjektivität ausrichtet. Sie kritisiert somit nicht nur, dass Heideggers Subjektionsmodell auf der Unterstellung unter eine weiblich Ursprungsmacht basiert, sondern auf einem Akt ideologischer Unterstellung überhaupt (vgl. 74). Dies ist insofern bemerkenswert als neuere feministische Subjekttheorien wie etwa von Judith Butler (Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Suhrkamp 2001) nach wie vor an dem von Althusser vorgegebenen Modell festhalten. Doch für Lettow ist entscheidend, dass Ideologie – im Unterschied zu Althusser – nicht als „Ewiges“ gedacht wird und somit kritisierbar bleibt – denn nur dann kann es die Perspektive einer nicht-ideologischen Subjektwerdung überhaupt geben. Und so verweist Lettow – will sie sich nicht nur von Heidegger als patriarchalem Theoretiker, sondern auch vom SubjektTheoretiker abgrenzen – mit Brecht und Gramsci auf emphatisch auf die „Aktivität eines Sich-kohärentmachens“, bei der es darum geht, zu den „sich hinter dem Rücken der Individuen herstellenden Zugehörigkeiten ein bewusstes, kritisches und aktiv-gestaltendes Verhältnis herzustellen“ (172). Dass eine derartige Arbeitsperspektive letztlich wohl nicht unproblematisch ist, läßt sich mit einem Blick auf Slavoj ÎiÏek vermerken, der die cartesianische Subjektivität rehabilitiert, gerade indem er am Unbewußten festhält. In Die Tücke des Subjekts (Suhrkamp 2001) versucht er nachzuweisen, dass postcartesianische Philosophien exzessive Momente wie das „diabolische Böse“ (Kant) oder die „Nacht der Welt“ (Hegel) enthielten, die sie allerdings sofort zu „normalisieren“ trachteten. Für Heideggers Philosophie hingegen konstatiert er eine Leerstelle; Heideggers Begriff von Subjektivität scheine „diesen innewohnenden Exzess nicht in Betracht zu ziehen“, er decke „jenen Aspekt des Cogito nicht ab, von dem Lacan sagte, er sei das Subjekt des Unbewussten." (ÎiÏek, a.a.O., 89). Damit erschließt sich für ihn auch Heideggers Nazismus in neuer Weise. Anders als Heidegger es nachträglich glauben machen wollte, war dies keinesfalls den unreflektier- Neuerscheinungen ten subjekt-philosophischen Resten seines Denkens geschuldet – etwa dem Dezisionismus –, sondern eher ein Versuch, den Konsequenzen dieses exzessiven Potentials neuzeitlicher Subjektivität in der Überantwortung an eine geschichtsmächtige Instanz auszuweichen. Mit ÎiÏek ließe sich nun fragen, ob Lettow nicht einer falschen Alternative Heideggers aufsitzt, wenn sie einerseits das von Althusser in die marsche Philosophie eingebrachte „Unbewusste“ exkludiert (vgl. 74), sich somit gleich Heidegger vom „exzessiven Potential neuzeitlicher Subjektivität“ verabschiedet, andererseits aber dem völligen Ausgeliefertsein des heideggerschen Subjektionsmodells einen Vernunftsbegriff entgegensetzt, der darauf abhebt, Leben liesse sich umfassend rational „aneignen“ (vgl. 99f, 171f). Für die in Aussicht gestellte weitere feministische Aneignung Heidggers könnte dies vielleicht eine spannende Fragestellung sein, der das Buch mit seiner Fülle des ausgebreiteten Materials bestens entgegenkommt. Rainer Alisch Thema wäre, sondern weil diese Arbeit, die vom Frankfurter Fachbereich als beste Dissertation des Jahres 1999 ausgezeichnet wurde1, imstande ist, nicht nur auf formal historische, sondern auch auf wissenschaftstheoretische und philosophische Implikationen auszugreifen, die sich im Rahmen einer kritischen Insichtnahme wissenschaftlicher Annäherung an die gesellschaftlich verfaßte Welt als von großer Bedeutung erweisen. Streng genommen, kann die vorliegende Arbeit (vermutlich, ohne daß dies dem Autor wirklich bewußt geworden ist) auch als ein Gegenentwurf zu einem von mir vor einiger Zeit besprochenen, eher programmatisch ausgerichteten und als solchen auch deklarierten Sammelband aufgefaßt werden, den ich seinerzeit allerdings überwiegend zu bemängeln hatte.2 Denn ohne es explizit zu erwähnen, wird in diesem Text, der sich in der Hauptsache mit einer Untersuchung der Bedeutung von Symmetrieprinzipien für die moderne Physik befaßt, ein Programm entworfen, das An der Universität Frankfurt/Main ist das Institut für Wissenschaftsgeschichte dem Fachbereich Physik zugeordnet und nicht dem Fachbereich Philosophie. 2 Es handelt sich dabei um die Festschrift für W.G.Saltzer, nämlich P.Eisenhardt, F.Linhard, K.Petanides (eds.): Der Weg der Wahrheit. Aufsätze zur Einheit der Wissenschaftsgeschichte. Hildesheim, 1998 (Olms). Meine Besprechung dazu ist R.E.Zimmermann: Wo eine Wahrheit ist, da ist auch ein Weg. Anmerkungen zu einer neuen Einheit. System & Struktur VII/1&2, 1999, 159-164. 1 Frank Linhard Historische Elemente einer Prinzipienphysik (Texte und Studien zur Wissenschaftsgeschichte, Band 3), Hildesheim, Zürich, New York 2000 (Olms), Pb., 258 S., 29.80 EUR . Ich möchte die Aufmerksamkeit auf dieses Buch (tatsächlich eine Dissertation) lenken, nicht, weil sein Thema, die Physikgeschichte, für den „Widerspruch“ ein sehr geläufiges Neuerscheinungen auf die Systematik wie Methodik der Reflexion am Beispiel einer Naturwissenschaft geht und sich dabei noch der Argumentationslinie von Leibniz her zu versichern imstande ist.3 Vor allem im Hinblick auf eine Prinzipienphysik gelingt es dem Autor auf erhellende Weise, die philosophischen Implikationen mit Verweis auf das Verhältnis der Physik zur Metaphysik einerseits und auf die Rolle von apriorischen Vorannahmen andererseits herauszuarbeiten. [215 ff.] Die kritische Relevanz dieser Ergebnisse liegt im folgenden: Nicht nur wird nämlich dabei über die Position des Experimentes als eindeutiges Realitätskriterium verhandelt, sondern es wird auch die Einordnung eines theoretischen Kerns von Philosophie ermöglicht, welcher sich als ultima philosophia versteht, eher denn als prima philosophia im ursprünglichen, AristoteWie es häufig in einem primär auf die Physik abzielenden Text geschieht, geht auch Linhard nicht zureichend hinter die Einsichten Leibnizens auf jene Spinozas zurück. Seit den wissenschaftstheoretischen Diskussionen im Umkreis von Einstein, Reichenbach, Cassirer und anderen im Zusammenhang mit dem Machschen Prinzip, also namentlich in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, dominiert immer der Rekurs auf Leibniz. Das gilt noch heute für die aktuelle Diskussion über philosophische Aspekte der Quantengravitationstheorie, wie sie etwa von John Baez, Julian Barbour, Christopher Isham, Louis Kauffman und Lee Smolin gegenwärtig geführt wird. Das ändert aber nichts daran, daß der Urheber dieser Argumentation eher Spinoza ist. 3 lischen Sinne. [17 Anm. 5] Außerdem wird hierbei einem systematischen Denken das Feld bereitet, welches sich gerade heute, in der Zeit der interdisziplinär (und auch interkulturell) verknüpften Begründungsprojekte von Welthaftem, als von großer Dringlichkeit erweist. Beispielsweise könnten viele theoretische Umwege in der Philosophie des Geistes erspart werden, würde man dieser dieselben Grundlagen voranstellen, wie das im vorliegenden Text für den Fall der Physik expliziert worden ist.4 Das heißt, man sieht hier an einer Arbeit, die einen kleinen, wenn auch zentralen Ausschnitt aus der physikalischen Forschung thematisiert, wie die Grundidee im Großen mit weitgehenden Konsequenzen fortgeführt werden müßte. Nüchternheit und rational verfaßte Herangehensweise sind hierfür die ersten Kriterien, die sich ihrerseits auf der Basis eines angemessenen Naturbegriffs erheben, in dessen Rahmen der Mensch eine eher depotenzierte Position einnimmt. Und in der Tat ist ein solcher, als Konsequenz aus dem hier Dargelegten folgender Naturbegriff das Desiderat unsereres neuen Jahrtausends. Mithin sei das hier besprochene Buch allen philosophisch Interessierten ausdrücklich empfohlen. Rainer E. Zimmermann Michael Pauen Das von mir hierselbst besprochene Buch von Pauen ist in dieser Hinsicht gerade ein Negativbeispiel. 4 Neuerscheinungen Grundprobleme der Philosophie des Geistes Eine Einführung. Frankfurt/Main 2001 (Fischer), 320 S., brosch., 14.90 EUR. Wie der Autor gleich zu Beginn so richtig bemerkt, scheiden sich „(a)n der Philosophie des Geistes ... die Geister“, nämlich im Hinblick auf die Frage, ob sie etwas nützen könne bei der Aufklärung von Problemen, die mit dem Aspekt des Geistes verbunden sind. Zugleich entwirft er ein düsteres Schreckensbild vom Rest der Philosophie, namentlich der Naturphilosophie, und fragt, ob auch die Philosophie des Geistes das Schicksal anderer philosophischer Gebiete teilen und mithin durch die empirischen Wissenschaften verdrängt werden wird. Wie auch bei anderen Veröffentlichungen des Autors zu diesem Thema, beginnt mit dieser Grundvoraussetzung, dass es nämlich auch wirklich so sei, wie es das hier entworfene Bild androht, das wahre Problem des Textes. Und insofern fügt sich der vorliegende Text in eine Strategie ein, die vor allem im Umkreis einer Gruppe jüngerer Philosophen und Wissenschaftler verbreitet ist, die ich etwas kursorisch als „Kreuzritter der Philosophie“ bezeichnen möchte, also mit einem Titel, der ursprünglich wohl nur auf einen ihrer früheren Hauptprotagonisten, der an dieser Stelle nicht erwähnt werden soll, angewendet wurde. Seinerzeit erschien ein dicker blauer Band zum Thema „Bewusstsein“, den ich an anderem Orte be- reits zureichend beschrieben habe.5 Ich hatte damals schon darauf hingewiesen, dass mir das ganze Unternehmen eher als eine Art „modische Rettungsoperation zu konjunkturellen Zwecken“ zu dienen scheint, vor allem, um der Philosophie ein Problemfeld zu retten, das ihr ganz allein zukäme. Das modisch überbewertete Material aus der angelsächsischen Philosophie steht dafür allemal bereit.6 (Freilich weiß man ja im übrigen, wie das mit den Kreuzrittern am Ende ausgegangen ist.) Auch im vorliegenden Text wimmelt es nicht nur wieder von Ismen aller Art, sondern es werden auch die gängigen Accessoires dieses Modetrends nicht nur übernommen, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt. Das erkennt man im wesentlichen an zwei Punkten, auf die ich mich hier beschränken will7: Zum einen herrscht die Unklarheit der Formulierung R.E. Zimmermann: Materie und Bewusstsein. Klares und Unklares zu einem aktuellen Thema. System & Struktur V/1, 1997, 103-109. 6 Interessanterweise hatte damals sogar einer der eingeladenen Beiträger zu dem „Bewusstseinsbuch“, nämlich David Papineau, selbst ein solches Argument angedeutet. 7 Ein dritter Punkt wäre die chronische Abwesenheit der Literatur jener Bewusstseinsforscher, Philosophen wie Wissenschaftler, die anderen Denklinien folgen. Unter anderem wären hier Hameroff und Penrose zu nennen, aber auch die „Gegenpartei“ der Quantengravitationstheoretiker, die sich durchaus zum Thema zu äußern imstande sind. 5 Neuerscheinungen vor (obwohl doch eine sich als analytische Philosophie verstehende Denkweise gerade immer die eigene Fähigkeit zur klaren, korrekten usw. Formulierung hervorzuheben pflegt). Nur einige Beispiele hierzu: „Wir wollen schließlich nicht nur wissen, was gemeint ist, wenn von Bewusstsein und seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen gesprochen wird; wir wollen zweitens auch wissen, was Bewusstsein ‚tatsächlich ist‘“ heißt es im Überblick. (9) Wenn wir davon ausgehen, dass auch das Bewusstsein lediglich nach Maßgabe dessen modelliert wird, was wahrgenommen und theoretisch auf propositionale Weise darüber formuliert werden kann, dann fragt man sich freilich, was es denn bedeuten soll festzustellen, was etwas tatsächlich sei. Bezieht sich diese Bestimmung auf einen ontologischen oder auf einen epistemologischen Bereich? Und wenn auf den ersteren, welche Vorstellung von Ontologie schwebt dabei immer schon vor? Meinen wir mit „tatsächlich“ also, wie das Bewusstsein modaliter tatsächlich (also aktual) sei oder wie es realiter wirklich ist? Oder: „Es gibt mittlerweile überzeugende Belege dafür, dass eine Theorie des Mentalen (Theory of Mind) konstitutive Bedeutung sowohl für den Zugang zu unseren eigenen mentalen Zuständen wie zu denen anderer Personen hat. Kleinkinder, die noch nicht über eine solche Theorie verfügen, machen daher charakteristische Fehler bei der Selbst- und Fremdzuschreibung von mentalen Zuständen.“ (97) Abgesehen davon, dass die hier angedeutete Übersetzung nicht vollständig überzeugt, fragt sich folgendes: Tre- ten diese Fehler der Zuschreibung auch bei Erwachsenen auf, welche die Theorie nicht kennen? Die an dieser Stelle für später angekündigten näheren Ausführungen zu der fraglichen Theorie (266 ff.) erweisen sich dabei als eine Aufzählung von Ergebnissen der klinischen Entwicklungspsychologie.8 Die Frage wäre hier natürlich, inwieweit der Autor sich vertrauensvoll aus dem Inventar empirischer Ergebnisse (welchem methodischen Ansatz sie auch immer entstammen mögen) bedienen darf, wenn er sich doch zu Beginn seines Textes so deutlich gegen das „bloß“ empirisch Eingesehene wendet? Zum zweiten reproduziert der Autor auch gängige Auffassungen, die eher dem Wunschdenken geschuldet sind, als der Einsicht in den „harten“ Beleg: Wenn man dort noch um eine Seite zurückblättert, stößt man auch sogleich auf einen Eintrag zu Oerter und Montada, zwei Autoren, die vor längerem ein Standardwerk zur Entwicklungspsychologie veröffentlicht haben, das allerdings nur ein – durchaus umstrittenes – Segment möglicher Forschungsansätze repräsentiert. Die Frage, inwieweit die im Vorliegenden referierten Ergebnisse wirklich verbindlich sind, wird vom Autor freilich nicht thematisiert. Aber das wäre gerade die Aufgabe der Philosophie: nicht das zu referieren, was mehr oder weniger willkürlich aus der Fachliteratur einer Einzelwissenschaft herausgesucht worden ist, sondern den Forschungsstand auf seinen Gesamtzusammenhang hin kritisch zu befragen und dann an diesem aufzuzeigen, was nicht mehr zureichend Gegenstand dieser Wissenschaft sein kann. 8 Neuerscheinungen Beispielsweise geistert wieder einmal die berühmte Nagelsche Fledermaus durch den Text, und gleich zu Beginn wird die Frage gestellt, ob eine vollständige Theorie der neuronalen Prozesse von Fledermäusen auch eine Vorstellung von deren mentalen Zuständen implizieren könne. (10)9 Die Antwort soll naheliegenderweise sein: Nein, denn die bloße Einzelwissenschaft (Biologie usw.) kann das „Eigentliche“ des Mentalen ja niemals zureichend erfassen. Dazu bedarf es der Philosophie. Die tatsächliche Antwort ist tatsächlich: Nein – freilich mit der wesentlichen Einschränkung, dass die besagte Theorie gleichwohl die Manipulation der Zustände bewirken kann. Aber die Vorstellung davon wäre uns natürlich in jedem Falle fremd, einfach deshalb, weil wir keine Fledermaus sein können. Und wenn wir eine wären, könnten wir unsere Einsicht nicht mehr auf propositionale Weise formulieren. Wir können uns ja noch nicht einmal zureichend genau vorstellen, wie die mentalen Zustände anderer Menschen beschaffen sind – eine alte Weisheit der hermeneutisch verfassten Philosophie, allerdings nicht der analytischen – wie sollten wir das also im Falle der Fledermäuse können?10 Wie so oft, hatte einst Natürlich kommen auch die bei solcher Gelegenheit aufzuzählenden „Farbblinden“ zu ihrem Recht. 10 Im übrigen ist das Bewusstsein „klassisch-makroskopisch“, wenn es auch aus Mikroskopischem emergiert – wie das ja in der Natur immer ist. Und so, wie wir nicht „quantentheoretisch“ wahrnehmen und denken können, können wir 9 der Kollege Nagel eine weitoffene Tür eingerannt und nachher behauptet, sie sei verschlossen gewesen. Heute wird das dann permanent nachgebetet. Insofern also können wir beruhigt sein: Wieder ein Buch, das wir uns ersparen können. Traurig nur, dass sein Inhalt schon seit längerem in Seminaren Verbreitung findet und auf diese Weise Einseitigkeit und Halbwissen unter arglose Studierende befördert. Rainer E. Zimmermann Martina Plümacher, Volker Schürmann, Silja Freudenberger Herausforderung Pluralismus Festschrift für Hans Jörg Sandkühler, Frankfurt/Main 2000 (Peter Lang), Pb., 356 S., 51,10 EUR. Die vorliegende Festschrift für Hans Jörg Sandkühler anläßlich seines 60. Geburtstages ist dem Thema „Pluralismus“ gewidmet. Ausgangspunkt ist die Überlegung, welchen theoretischen und praktischen Konsequenzen des Umstandes Rechnung zu tragen sei, daß die Gesellschaften auf diesem Planeten im Zuge der fortschreitenden „Globalisierung“ und „Migration“ faktisch bereits plural verfaßt sind. Vor allem wird dabei auch nach den Invarianten und Vereinheitlichungsprinzipien gefragt, die in einer Pluralität der Perspektiven und Konstruktionen auffindbar sein mögen. Unter den Rahmentiteln „Einheit und Vielheit“ (17-77), „Philosophie der Geschichte(n) und Geschichte(n) auch nicht „neurologisch“ wahrnehmen und denken. Neuerscheinungen der Philosophie“ (81-162), „Marxismus und Pluralismus“ (165-217), „Pluralismus und Ethik“ (221-266) sowie „Pluralismus in Recht und Politik“ (269-326) ordnen sich insgesamt 24 Beiträge an, von denen die meisten insofern gelungen erscheinen, als sie das selbstgesetzte Problem zureichend zu behandeln imstande sind. Ein breites thematisches Spektrum wird abgedeckt, von der Besprechung einer neuen Wende in der lateinamerikanischen Philosophie (von Raúl FornetBetancourt, 17-24) über Aspekte von Weisheit (Arnim Regenbogen, 57-67) und Hegemonie (Volker Schürmann, 69-77), über den Wirklichkeitsbegriff bei Schelling (Martin Schraven, 135-145) und den pluralen Marxismus (Wolfgang Fritz Haug, 179-194), bis hin zur Frage der Geschlechterdifferenz (Choe Hyon Dok, 269-276). Daneben behandeln auch die übrigen Beiträge von Silja Freudenberger, Gerhard Pasternack (Themenkreis 1), Félix Duque, Lothar Knatz, Lars Lambrecht, Detlev Pätzold, Pirmin Stekeler-Weithofer (Themenkreis 2), Gian Mario Bravo, Thomas Metscher, Friedrich Tomberg (Themenkreis 3), Kurt Bayertz, Winfried Franzen, Wilhelm G. Jacobs, Martina Plümacher (Themenkreis 4), Werner Goldschmidt, Domenico Losurdo, Juha Manninen und Georg Mohr (Themenkreis 5) vielseitige (eben plurale) Fragestellungen im Zusammenhang mit der Hauptthematik. Hervorzuheben ist die interessante Diskussion Schürmanns, auf einer marxistischen Grundlage bei der Entgegensetzung von Pluralismus und Monismus anzusetzen und in eine Thematisierung der ge- sellschaftlichen Grundnormen und des Verhältnisses von Politik und Recht einzumünden, dabei zugleich den Aspekt einer möglichen interkulturellen Philosophie streifend. Gleichfalls die Betrachtung Schravens zur Rolle der negativen und positiven Philosophie bei Schelling. Vor allem die Gegenüberstellung von Transzendenz und Immanenz (141-145) erscheint hierbei sehr erhellend. Nur selten erweisen sich Texte als wenig befriedigend: Beispielsweise hätte man sich in dem ansonsten anregenden Aufsatz von Plümacher zum Toleranz-Thema (255-266) etwas genauere Ausführungen zu den Grenzen der Toleranz gewünscht. Sowohl dieses Thema als auch das von Georg Mohr: Menschenrechte, demokratische Rechtskultur und Pluralismus (315-326) sind ja aus aktuellem Anlaß Gegenstand der augenblicklich laufenden Ethik-Diskussion. Auch bei dem letzteren Aufsatz hätte man sich einen deutlicheres Ergebnis hinsichtlich der Frage gewünscht, inwieweit Menschenrechte auf eine universale, im wahrsten Sinne des Wortes inter-kulturelle, Fundierung gestützt werden können oder nicht. Noch seltener entsteht der Verdacht, daß sich die bewußte Besetzung vermeintlich „linker“ Themen mitunter zu Lasten der wissenschaftlichen Stringenz auswirkt, wie zum Beispiel in dem Aufsatz von Choe, der Auffassungen von Butler und Heinämaa recht undifferenziert gegenüberstellt, wenn auch seine Diskussion des semantischen Unterschiedes zwischen sex und gender nicht uninteressant ist. (270 ff.) Allerdings sollte jede feministische Kritik an Simone de Beauvoir zu- Neuerscheinungen nächst unter den Ideologievorbehalt gestellt werden. Der vorgelegte Band überzeugt auch in der äußeren Form des Layouts (sein Schriftbild etwa richtet sich nicht nur an optisch Hochbegabte, wie das ja neuerdings immer mehr zur Regel wird). Ein Lebenslauf Sandkühlers sowie dessen Schriftenverzeichnis vervollständigen eine abgerundete Darstellung, bei der man allenfalls noch den eher „onto-epistemischen“ Sandkühler vermißt. Alles in allem eine sehr gelungene and anregende Sammlung. Rainer E. Zimmermann Katherine Stroczan Der schlafende DAX oder das Behagen in der Unkultur Die Börse, der Wahn und das Begehren, Berlin 2002 (WagenbachVerlag), 109 S., 18,50 EUR. Alles Psycho-Raffkes – oder was? Der Deutsche Aktienindex (DAX) dümpelte über die Jahre fast unbeachtet vor sich hin. Ab Mitte der 1980er Jahre aber jagte eine Hausse die nächste. Der DAX explodierte förmlich, schoß bis März 2000 auf über 8 000 Punkte. Seither jagt eine Baisse die andere. Der DAX sauste in den Keller; nun liegt er weit unter der Hälfte des Höchststandes, und beim Nemax verlief die Bergund Talfahrt noch viel rasanter. Für viele Millionen spätberufener Anleger mußten Aktiengeschäfte beinahe notwendig zu einem verlustreichen finanziellen Abenteuer werden. Statt auf die seit geraumer Zeit nur noch fallenden Aktien-Indices zu starren, wählt Katherine Stroczan eine gewiß amüsantere Variante, wenn sie das Geschehen rund um die Börse aus psychoanalytischer Sicht einzuordnen versucht. Das an den Börsen grassierende Fieber der vergangenen Jahre beruhe auf einer ausgefeilten Beziehung zwischen den Medien, die das dortige Geschehen von selbsternannten Experten garkochen lassen, und den dieser Beeinflussung beinahe wehrlos ausgelieferten Investoren. Diese dubios-sinistre Beziehung bildet den zentralen Bezugspunkt der Autorin, die sich mit vielleicht zugrundeliegenden ökonomischen Zusammenhängen nicht länger aufhält, sondern ihre vielgestaltige Analyse des – ihr nur virtuell zugänglichen – Anlegers qua Berichterstattung auserwählter Printmedien und Fernsehsendungen angeht. Die Autorin macht einen von den Medien geschaffenen neuen Typus von Mensch, den Homo investor, aus, der durch einen – natürlichen und/oder oktroyierten – zu nackter Gier entsublimierten Affekt getrieben, dem Imperativ des ‚ultimativen Coups‘ folgt – wobei sie wohlweislich offen läßt, wie der beschaffen sein könnte. Die Gesamtheit dieser neuen menschlichen Sub-Spezies sieht sie als Anleger-Horde, die – vergleichbar einer Glaubensgemeinschaft – auf gemeinsame Verhaltensweisen eingeschworen wird: den ‚cleveren Anleger‘ als Ziel und Sinn. Erfolge gelten als sakrosankte Maxime der Börsianer; diese Erfolge leben sich aber weniger in Gewinnen und Verlusten, als vielmehr in einem breiten Spektrum komplexer psychischer Pathologien (mit einer beeindruckenden Fülle strategischer Neuerscheinungen Instrumente) aus. Keine andere Institution, insinuiert die Autorin, verfüge über gleichwertige Mittel, die Gesamtheit pathologischer Phänomene auf eine Weise zu binden, wie es der Börsengemeinde gelingt. Die Börse sei daher das Feld, auf dem mittels Triebregression gleichzeitig anal- und oralsadistische Triebregungen agiert, ödipale Konflikte wiederbelebt und narzistische Regressionsversuche unternommen werden können. Bei einer dermaßen triebgesteuerten Tätigkeit, bei welcher der Höhepunkt nie erreicht werden könne, sei die postkoitale Tristesse die zwangsläufige Konsequenz jeglicher Tätigkeit und die einzige Invariable. Möglicherweise sei mit der Erschaffung dieses vollendeten Konstrukts die herkömmliche Sexualität inzwischen ganz ersetzbar, biete die Gier doch viel frequentere, jederzeit abrufbare, objektunabhängige und störungsfreie Befriedigung auf der Jagd nach virtuellem und realem Erfolg. Ob die immerhin annähernd 6 Millionen Menschen in Deutschland, die Aktien besitzen, wohl eine Ahnung davon haben, wie es um sie bestellt ist? Ganz zu schweigen von jenen, die ihre Aktien mit Krediten kauften oder als Alterssicherung erwarben und nun vor dem Ruin ihrer Existenz stehen. Freilich ist dies vornehmlich in den USA der Fall, und vielleicht gilt dort eine andere Börsen-Psychoanalyse. Was aber ist, wenn die deutschen Anleger an der medialen Berichterstattung weit weniger interessiert sein sollten als Katherine Stroczan? So amüsant der Ansatz sein mag, das Börsengeschehen psychoanalytisch zu betrachten, so problema- tisch muß es erscheinen, derart generös zu generalisieren, denn vielleicht ist ja alles auch ganz anders. Eine Supervision gelegentlich ist jedenfalls nie verkehrt. Bernd M. Malunat Charles Taylor Die Formen des Religiösen in der Gegenwart IWM-Vorlesungen zu den Wissenschaften vom Menschen, aus dem Englischen v. Karin Wördemann, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), 102 S., 8 EUR. Charles Taylor (geb. 1931) umkreist in seinen Werken immer wieder das Thema der menschlichen Identität. Beginnend 1975 in seiner umfangreichen Untersuchung zu „Hegel“ und vier Jahre später in „Hegel and Modern Society“ betonte er die Notwendigkeit einer Revision des modernen liberalistischen Menschenbildes, in dem das Individuum völlig unvermittelt und aus freien Stücken seine Identität formieren soll. Mit seiner Aufforderung, menschliche Identität im „kulturellen Milieu“ zu verankern, schwenkte er mit den Publikationen „What's Wrong with Negative Liberty?“, vor allem aber mit „Sources of the Self“ in die Phalanx kommunitaristischer Kritik am liberalen unencumbered self (uneingebetteten/unverankerten Selbst) ein. Später, in den späten 80er und 90er Jahren, betonte er – ähnlich wie A. Honneth, aber unabhängig von diesem – den Begriff der Anerkennung (recognition) als identitätsbildendes Moment. Anerkennung bezog er Neuerscheinungen dabei auch politisch auf das Selbstbestimmungsrecht kultureller Gruppierungen und ging sogar so weit, in seinem Kampf für die Unabhängigkeit Quebecs gegen den kanadischen Premierminister Trudeau anzutreten. Auch der vorliegende Band „Formen des Religiösen“ behandelt das Thema der kulturellen Verankerung menschlicher Identität, diesmal unter dem Blickwinkel religiöser Überzeugungen. Dabei knüpft Taylor an die Fragestellungen an, die in „Sources of the Self“ bereits aufgeworfen und behandelt wurden. Dort wurde nach der Fundierung einer Ethik ohne theistische Basis – genauer: nach dem Ende theistischer Systeme – gefragt und die neuen moralischen Quellen in dem festgemacht, was Taylor expressivistische (expressivist) Formen von Moral nannte. In „Formen des Religiösen“ wird dieser Ansatz wieder fruchtbar gemacht. Dieser Band ist die Ausarbeitung von Vorlesungen, die er am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen im Jahr 2001 hielt. Ausgangslage und Quelle seiner Überlegungen ist die 1902 erschienene Schrift des Pragmatisten William James (1842-1910) „Die Vielfalt religiöser Erfahrung“ (Varieties of Religious Experiences), die heute noch in den USA als wegweisende Kulturtheorie angesehen wird. Der erste Teil, „Was ist religiöse Erfahrung?“ überschrieben, beschäftigt sich mit James’ Theorie religiöser Erfahrung, genauer mit dem, was James als Kern von Religion betrachtete. Im zweiten Teil, „Die Zweimalgeborenen“, wird das „eigentliche Herzstück der Jamesschen Diskussion“ behandelt, worin James seine religiöse Kultur- und Gesellschaftstheorie entwickelt. Zentral hierfür ist dessen Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Agnostizismus in der Moderne. Taylor entdeckt James dort als den „Philosophen der Schwelle“, der jedoch die Religion noch gegen skeptizistische, szientistische wie rationalistische Einwände verteidigt. Im dritten Teil des Bandes, „Religion heute“ überschrieben, wird dann das zuvor erarbeitete Instrumentarium auf die modernen Formen von Religion angewendet und unter zwei Stichworten diskutiert: Säkularisierung der Öffentlichkeit und Individualisierung von Spiritualität. Abgerundet wird die Schrift in ihrem vierten Teil von einer Diskussion der Frage „Hatte James also recht?“. Im ersten Teil des Bandes versucht Taylor James’ Auffassungen von Religion nachzugehen. Für diesen liege der wirkliche Ort von Religion klar auf der Seite „der individuellen Erfahrung und nicht im körperschaftlich verfassten Leben“ (13), also der Kirche, der Religionsgemeinschaft oder kanonischen Regularien. Erfahrung (experience) ist nach James etwas Individuelles und Ungeteiltes; und Individualität „ist im Gefühl begründet“ und nicht in den Ideen, den Theorien oder – wie er es auch antirationalistisch ausdrückt – in der Vernunft. James war überzeugt, dass die Theorien der Religion „variabel und sekundär“, während Gefühle deren „konstantere Elemente“ seien. Damit wandte sich James nicht nur gegen die seinerzeit gängige Auffassung, wonach die Religion im we- Neuerscheinungen sentlichen aus gemeinschaftlich vereinbarten und schriftlich fixierten Glaubensüberzeugungen zu bestehen habe. Er versuchte damit, aus zwei Grundproblemen von Religion zu entfliehen: erstens dem Agnostizismus: Religion sei zu verwerfen – so der Agnostiker –, wenn die Vernunft sie als unhaltbar einstufe; und zweitens allen deontologischen Ethiken, wonach es jedermanns/fraus Pflicht sei, Geboten zu folgen, selbst wenn das Gefühl oder die Neigung sich dagegen sträube. Gleichzeitig steht James mit seiner Auffassung von persönlicher Religion in einer langen Tradition. Mit viel Sachverstand und sehr kenntnisreich versteht es Taylor, James’ Theorie in den historischen Zusammenhang der meist spiritualistischen Religionsauffassungen einzuordnen, etwa des Jansenismus oder des religiösen Humanismus des 17. Jahrhunderts. Was nach Taylor jedoch James’ Modernität ausmacht ist weniger die Betonung der Individualität, der Spiritualität und des Persönlichen von Religion als vielmehr der Umstand, dass dies im Rahmen einer essentialistischen Rückzugsstrategie geschieht, welche die Religion unangreifbar machen soll. Religion, die ihren Stellenwert im öffentlichen Raum eingebüsst hat, soll sich auf ihren Kern konzentrieren: die individuelle religiöse Erfahrung. James erkennt die Säkularisierung des sozialen Lebens wie die Trennung von Kirche und Staat an und reagiert darauf mit der Theorie persönlicher Religiosität. Taylors erster Kritikpunkt an James wendet sich gegen dessen individualistische Einseitigkeit: so klammere er alles religiöse Leben aus, wobei doch kollektive Erfahrungen konstitutiv für religiöse Erfahrung werden. Man denke an die Gebets- und Versammlungs-Rituale. Zum zweiten wendet er sich gegen James’ radikalen Individualismus in Form eines Privatsprachenarguments – wie kann jemand persönliche Erfahrung haben, ohne auf eine geteilte Sprache zurückzugreifen? – und drittens gibt er gegen James’ Emotivismus und Intuitionismus den Kantsche Einwand gegen Hume zu bedenken, wie denn Erfahrung ohne Form (Begriff) möglich sei. Im zweiten Teil, „die Zweimalgeborenen überschrieben, stellt Taylor dar, dass es James im Wesentlichen darum gegangen sei, agnostischen Einwänden der Moderne zu begegnen. Er sah in der Moderne Bedrohungspotenziale, die er mit dem Begriff der Melancholie umriss. Melancholie stand für ihn für den vollständige Sinnverlust, den ennui, die grenzenlose Langweile des modernen entgrenzten Individuums. In einer Welt ohne Sinngarantie suchte James nach Argumenten, die den Schuldigen, den religiösen Skeptizismus (Agnostizismus), entkräften sollten. Hauptschuldiger in der Gemeinschaft der Agnostiker war für ihn der Rationalismus/Szientismus und dessen Postulat, dem gemäß nur das als wahr anerkannt werden könne, was zweifelsfrei bewiesen werden könne. James argumentierte dagegen mit der Formel Cliffords: „Lieber den Verlust von Wahrheit als die Möglichkeit einen Irrtum zu riskieren!“ (45). Das heißt: wenn wir vor der Wahl stehen, ein Gut (Gott) zu verlieren, nur weil wir es nicht zweifelsfrei als wahr beweisen können, oder Neuerscheinungen an diesem Gut festzuhalten, auch wenn wir es nicht beweisen können, dann sei es zweckmäßiger, das Prinzip der Beweispflicht aufzugeben als das Gut. Taylor entgegnet solchen Spitzfindigkeiten, dass auch umgekehrt ein Dilemma konstruiert werden könne, und dass der Streit nicht entscheidbar sei. Entscheidender für ihn ist die Verortung von James als dem „Philosophen der Schwelle“, als einem Denker, der versuchte, dem Verlust kollektiver Sinnhorizonte nachzuspüren und gegen sie eine Theorie personaler Religiosität zu errichten. Hatten die vorigen Kapitel die Religion mit Hilfe der Jamesschen Theorie als Ort persönlicher Erfahrung angesehen, so greift Taylor auf diese zurück, wenn er sich jetzt den Formen des Religiösen in der Gegenwart zuwendet. Grundlage bilden die Einsichten James’, die sich in zwei Thesen zusammenfassen lassen: 1. das öffentliche Leben unterliegt einer immer stärker werdenden Säkularisierung; oder anders formuliert: der soziale Rahmen duldet zunehmend weniger die Wiederspiegelung bestimmter Glaubensüberzeugungen. 2. Spiritualität im Sinne personaler Religion schafft immer weniger kollektive Bindungen; oder anders formuliert: Religiosität wird zunehmend personal und individuell. Taylor macht auf eine beispiellose Weise die Geschichte der religiösen Begründungen von Gesellschaft auf, die zu unseren modernen Auffassung führen: 1. Die Vor-Durkheimsche Auffassung von Gesellschaft und Religion: in dieser noch verzauberten Welt ist das Sakrale allgegenwärtig. Gottes Vorsehung und Plan ist in der Gesellschaft und im Kosmos unmittelbar präsent. 2. Die Paläo-Durkheimsche oder die barocke bzw. katholische Auffassung von Gesellschaft und Religion: hier ist das Sakrale nur mehr im politischen Gemeinwesen präsent und zwar als Idee der sittlichen Ordnung (Locke). Die Kirche als körperschaftlicher Ausdruck des Sakralen selbst ist mit der Gesellschaft deckungsgleich. Die Zugehörigkeit zur Kirche wird mit der Zugehörigkeit zur Gesellschaft als politisch-sittlichem System gleichgesetzt. 3. Die Neo-Durkheimsche oder die protestantische Auffassung von Gesellschaft und Religion: in ihr taucht zum ersten Mal das Moment der individuellen Wahl von Religion auf. Mit ihr aber auch die Idee, dass es religiöse Überzeugungen geben könne, die nicht den Anspruch erheben, in einer körperschaftlichen Struktur für alle Menschen zu enden. Denominationen wie die Methodisten verstanden sich bewusst als eine Kirche für Wenige, eben nur für die, die die gleichen individuellen Erfahrungen teilten. Das Ergebnis war das, was Bellah „civil religion“ nannte. Die Trennung von Kirche und Staat war ihr historisches Ergebnis. 4. Die Post/Nicht-Durkheimsche oder expressivistische bzw. moderne Auffassung von Gesellschaft und Religion: In den Durkheimschen Auffassungen war noch das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Religion konstitutiv, und Neuerscheinungen das Individuum definierte sich als einer Gesellschaft zugehörig, indem es ihre religiösen Überzeugungen teilte und diese an einem Gott, einer Vorsehung festhielten. In der modernen expressivistischen Form von Religion hingegen wird das Moment der individuellen Wahl gestärkt, und es schwindet das Moment der Konfessionalität. Der Einzelne erlebt Spiritualität als Je-Eigenes – unabhängig von der Spiritualität anderer – und er erlebt es ohne den Rahmen des Sakralen, sei es die Kirche oder der Staat. Der größte Katalysator der expressivistische Auffassung von Religion ist nach Taylor die heutige individuelle Konsumkultur, insbesondere der Jugendkultur seit den 60er Jahren. Hier wurde die Ablehnung des Sakralen, der großen Beziehungsrahmen wie Kirche und Staat, mit dem Verweis auf das Recht der individuellen Wahl und Selbstbestimmung begründet. Der Begriff des Privaten wurde als das Recht definiert, eigene Wahlentscheidungen zu treffen, aber auch als die Pflicht anderer, diese unbedingt zu akzeptieren („Prinzip der Nichtverletzung“). Es bildeten sich neue horizontale Vorstellungen von Gemeinschaft, in der die Zugehörigkeit zu einer Gruppe nicht mehr unmittelbar, sondern über komplexere Beziehungen vermittelt ist. Beispiele hierfür sind Sport- oder Rockfans: die Fans halten nicht mehr an gemeinsam geteilten Überzeugungen fest, sondern treffen ihre Wahl der Zugehörigkeit aus ganz verschiedenen Beweggründen. Was die heutige Spiritualität selbst anbetrifft, sieht sich Taylor in seiner These radikaler Individualisierung weltweit bestätigt: konfessionelle Religionen befinden sich auf dem Rückzug, die Zahl derer, die persönlich an etwas Göttliches glauben, steigt. James’ Werk, wieder den Bogen zu dessen individualistischer Auffassung von Religion schlagend, sieht Taylor als Wegbereiter dieser modernen expressivistischen Formen von Religion. Taylors neuester Band ist hochinteressant. Er erfasst das vorwiegend soziologisch abgehandelte Thema auch in seiner historischen Dimension und erschließt so neue gesellschaftsphilosophische Horizonte dieses Themas. Dennoch scheint, trotz des unbestreitbaren Faktums, dass die Bedeutung konfessioneller Religion in der Moderne schwindet, Taylors Verortung neuer Gemeinschaftlichkeit und Religion im Konsum etwas vorschnell zu sein. Sind doch die horizontalen Bindungen freiwilliger Assoziationen zu schwach und in Staat und Gesellschaft zu unwirksam. Würde Taylor diese Schwäche expressivistischer Religiosität anerkennen, müsste er zum Ergebnis kommen, dass das Religiöse in der Gegenwart selbst auf dem Rückzug ist. Aber das mag man vielleicht für den Westen noch behaupten können; für andere Regionen der Erde ist das keineswegs schon entschieden. Wolfgang Melchior Peter Trawny Die Zeit der Dreieinigkeit Untersuchungen zur Trinität bei Hegel und Schelling, Würzburg 2002 (Königshausen & Neumann), 229 S., 29,50 EUR. Neuerscheinungen In Zeiten der Unsicherheit liebt man bekanntlich den Halt gebenden „Blick zurück“. Der Autor des vorliegenden Buches, seiner überarbeiteten Habilitationsschrift, bekennt denn auch im Vorwort freimütig, dass die „Zeit der Dreieinigkeit“, die dem Buch den Titel gab, vergangen ist: „Ich betrachte mein Buch als eine Erinnerung an ein Denken, das [noch] behaupten konnte, ‚bei sich zu Hause zu sein’“ (8). Nun hat ein solch distanzierender Zugang zur Thematik und Problematik der Hegelschen und Schellingschen Philosophie, zumindest im deutschsprachigen Raum, den Vorteil, nicht ‚aktualisieren’ zu müssen und sich den Kämpfen der Schulen zwischen und um Hegel und Schelling entziehen zu können. Sie kann sich insofern ‚vorurteilsfrei’ ihrem Untersuchungsgegenstand zuwenden. Dass dem Autor dies letztlich nur teilweise gelungen, zeigt das Ende seiner Untersuchung. Trawny gelingt zur anstehenden Thematik, der Trinität bei Hegel und Schelling, ein überzeugender Zugang und Einstieg: der ontologische Gottesbeweis, welcher aus dem Begriff Gottes auf dessen Existenz schließt. Denn dieser Beweis ist für die beiden Philosophiekonzeptionen zentral. Für Hegel ist Gott „eben dies, dass sein Begriff und sein Seyn ungetrennt und untrennbar sind.“ (34) Er ist so die „absolute Realität“ (ebd.) Für Schelling, der gerade durch die Kritik am „ontologischen Argument“ seine eigene „positive Philosophie“ bestimmt, ist es zumindest in historischer Hinsicht „für die ganze neuere Philosophie bestimmend geworden“ (SW I, 10, 14). Trotz dieser Differenz unternehmen es beide, Hegel wie Schelling, diesen ‚bewiesenen’ bzw. ‚sich beweisenden’ Gott als den christlichen, d.h. den dreieinigen, Gott auszulegen. Für Hegel, dem sich Trawny zuerst zuwendet, drückt der ontologische Gottesbeweis, wenn auch unvollkommen, das Prinzip der Philosophie aus: nämlich dass Vernunft ist. Dies aber, dass Vernunft ist, müsse trinitarisch gedacht werden, so wie der Christengott dreieinig ist. Was in der christlichen Religion in der Dreieinigkeit vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vorgestellt werde, sei in der Logik als der „Sphäre der immanenten Trinität zu denken“ (50; H.v.m.). Auf der Grundlage solcher „Analogie“ zwischen christlicher Religion und „reinem Denken“ widerspricht Trawny nun zurecht den Ansichten, Hegel habe seinen Begriff vom „Begriff“ gleichsam nachträglich auf das christliche Gottesbild angewandt, um ihn dadurch zu erläutern oder aus ihm die Trinität Gottes gleichsam abzuleiten (50). Er konstatiert demgegenüber ein anderes, engeres Verhältnis zwischen Begriff und Trinität bzw. zwischen dem Logischen und der Religion. Er spricht vom „theologischen Motiv, das Hegels ‚Wissenschaft der Logik’ von Anfang an begleitet“ (45). Dies macht Trawny an Hegels „Lehre vom Begriff“ bzw. dessen „drei Momenten“, der Allgemeinheit, der Besonderheit und der Einzelheit, fest und zitiert: „Das Allgemeine ist daher die freye Macht; es ist es selbst und greift über sein Anderes über; Neuerscheinungen aber nicht als ein gewaltsames, sondern das vielmehr in demselben ruhig und bey sich selbst ist. Wie es die freye Macht genannt worden, so könnte es auch die freye Liebe, und schrankenlose Seeligkeit genannt werden, denn es ist ein Verhalten seiner zu dem Unterschiedenen nur zu sich selbst, in demselben ist es zu sich selbst zurückgekehrt.“ (45) Wenn Trawny dazu anmerkt, dass dies „an das Verhältnis von Gott Vater und Sohn erinnert“ (ebd.), dann ist dies zu wenig. Wer nur etwas mit der Trinitätsdebatte vertraut ist, erkennt in diesem Begriff vom Allgemeinen unschwer eine der möglichen Lösungen des Trinitätsproblems: der Vater als die freie Macht, die den Sohn, das von ihm gezeugte Andere, „übergreift“ und durch den heiligen Geist, die Liebe, im Anderen zugleich bei sich bleibt. Darüber hinaus wäre es für eine Untersuchung der Trinität bei Hegel zweifellos angebracht gewesen, wenn Trawny diesem Verhältnis von Logik und Religion nicht nur anhand Hegels Lehre vom Begriff, sondern auch seiner Methode überhaupt nachgegangen wäre. Er zitiert zwar Hegels Diktum: „Die Logik ist insofern metaphysische Theologie, welche die Evolution der Idee Gottes in dem Äther des reinen Gedanken betrachtet“ (49); aber er zieht daraus nicht die Konsequenz, in Hegels Dialektik selbst das christliche Trinitätsmotiv zu erkennen. Denn wenn Hegel in der Einleitung zu seiner „Wissenschaft der Logik“ die Methode der Wissenschaft so beschreibt, dass das Andere oder das „Negative“, wie er hier sagt, nicht das parmenideische „abstrakte Nichts“ ist; es aber auch weder das platonische πολλα oder das Mehr oder Weniger ist noch das, was neuplatonisch dem Einen ‚ausfließt’; wenn es aber auch nicht – jüdisch – dem Einen, der schlicht bei sich ist, und auch nicht – spinozanisch – dem All-Einen zukommt; sondern wenn Hegel dieses Andere ganz bestimmt als die „bestimmte Negation“ bestimmt, in die das Eine oder „Positive“ „fort-geht“, „über-geht“ oder „sich ent-zweit“; es in dieser „Ent-Zweiung“ aber bei sich bleibt, und im Resultate daher „wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert“, – dann kann nicht nur diese Art der Negation als Negation der Negation, sondern auch Hegels Überzeugung, daß diese Methode die „wahre“ sei, gar nicht anders verständlich gemacht werden, als dass für ihn eben das christlich Trinitarische das an und für sich Wahre ist. So verstanden aber hat Hegels Dialektik nicht nur irgendein „theologisches Motiv“, sondern ist in ihrem Fundament christlich. Sie widerspricht damit sowohl heidnischem wie jüdischem Denken des Absoluten. Trawny stellt diesbezüglich zwar zurecht fest, dass für Hegel „ein Gott jenseits der Logik ... kein oder jedenfalls nicht der christliche Gott ist“ (50); aber er verdeutlicht nicht, dass der christliche Gott in der Logik, er diese Logik selbst ist. Diese, wie mir scheint, mangelnde Durchdringung mag daran liegen, dass Trawny ein anderes Interesse verfolgt, dass nämlich in solchem Denken sich für Hegel zugleich auch heilsgeschichtlich „die Zeit erfüllt“ (Paulusbrief an die Galater, 4, 4). Denn die Zeit und die Geschichte für ihn eben dies, dass der dreieinige Gott nicht nur vorgestellt und Neuerscheinungen verehrt wird, sondern dass er im menschlichen Geist zum Bewusstsein seiner selbst komme. Für Hegel ist daher die Jetzt-Zeit, die Gegenwart, die „Zeit der Dreieinigkeit“. Der „mittlere und spätere“ Schelling hingegen verhält sich kritisch gegenüber dem ontologischen Gottesbeweis. Trawny stellt den Einwand, den Schelling in „Zur Geschichte der neueren Philosophie“ formuliert hat, überzeugend dar: ein Gott, der existieren muss, ist kein freier Gott; denn er kann nicht nicht existieren. Für Schelling ist Gott daher nicht einfach das Sein, sondern der „Herr des Seyns“. Er ist nicht nur das notwendig existierende, sondern „das frei wollende Wesen“ (133). Trawny folgert daraus, dass sich für Schelling das Göttliche nicht, wie bei Hegel, in der Struktur des Logischen, sondern im Faktischen, in der Geschichte als dem Handeln Gottes offenbart. Unklar bleibt allerdings, worein nun Schelling das ChristlichTrinitarische solcher Geschichte setzt. Besteht das Christliche, wie er in den „Weltaltern“ schreibt, in dem geschichtlichen Faktum, dass ‚wir’ in ‚unserem’ Kulturkreis „von Kindheit auf“ christlich denken und „seine Lehren für das ganze Leben eine fast unabweisbare Gegenwärtigkeit erhalten“ (136)? Oder gilt, dass es das Christentum schon „von Ewigkeit her“ gegeben habe, „noch ehe eine Welt da war“ (137), so dass eine gleichsam vorgeschichtliche Trinität anzunehmen wäre? Wie aber verträgt sich dieser Gedanke mit der Geschichtlichkeit göttlicher Offenbarung? Oder aber ist es so, dass Geschichte überhaupt nur christ- lich, d.h. trinitarisch, gedacht werden könne, weil „jede Geschichte, die dies wirklich ist, ... drei große Unterscheidungen (hat), nämlich Anfang, Mitte und Ende, oder: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ (140 f.)? Und will Schelling damit sagen, dass die Geschichte zwar objektiv nur faktisch ist, dass sie aber als begriffene, als System, allemal nur christlich sein könne? Trawny lässt dies im Dunkeln. Er macht vielmehr mit Hinweis auf W. Schulz deutlich, dass dieses Ungelöste ein Strukturelement der Schellingschen Spätphilosophie selbst sei. Denn während Hegels Philosophieren sich als System erfüllt, habe Schelling solche Einsichtigkeit verneint „und die ‚Gründung’ des Ganzen in der ‚grundlosen Freiheit’ Gottes anerkannt.“ (189) Von Hegel her gebe es deshalb keine Möglichkeit, sinnvoll nach der Zukunft zu fragen; denn für ihn ist die Gottesherrschaft nichts ausstehendes, sondern wirklich. Für Schelling jedoch, dem das Zukünftige Strukturmoment von Geschichte ist, sei die Geschichte offen. Seine „Philosophie der Offenbarung“ verherrlicht nicht die Gegenwart, sondern begreift sie als „zerrissene Welt“ und ihr Heil als noch ausstehend. Sie sei „grundsätzlich eine eschatologische, also auf Zukunft bezogene Philosophie. Zeit und Geschichte werden grundlegend von der Zukunft her verstanden.“ (181) Darum aber sei für Schelling auch nur dasjenige Christentum, das die Erfüllung der Zeit in der Zukunft erblickt, die „wahre Religion“ (181). Während also Hegel die Geschichte von Jesus her denkt, durch den die göttliche Ver- Neuerscheinungen nunft wirklich geworden sei, denkt Schelling sie vom Parakleten, dem Künder des kommenden Zeitalters, her. Dieses Zukunftsbezugs wegen aber sei, läßt Trawny durchblicken, das Schellingsche Denken der Gegenwart adäquater. Am Ende seines Buches verlässt der Autor seine historische Untersuchung und geht so weit, dem gegenwärtigen Denken die jesuanische Botschaft vom kommenden Gottesreich – ganz unabhängig von aller Trinitätsdiskussion – als zukünftiges Denken anzuempfehlen. Wenn, so Trawny, die gegenwärtige „Pluralisierung und Globalisierung der Wohn- und Denkräume ... die Kennzeichen einer radikal gottverlassenen und d.h. nihilistischen Welt sind, dann ist jedes Nachdenken über Gott eine bloß sentimentaler Beschäftigung“ (210). Wenn es aber eine Heilung in der Zeit gebe, dann komme sie aus der Zukunft; ein einzigartiges Zukunftswissen aber enthalte die Predigt Jesu; denn diesem Wissen habe sich „noch keine philosophische Theorie ... als überlegen erwiesen“ (211). Dieser schließliche Distanzverlust zum Gegenstand bzw. das Schwanken zwischen historischer Untersuchung und aktualisierender Anempfehlung macht Trawnys Buch zweideutig. In der ersten Hinsicht bleibt manches, wie ich zumindest anhand Hegels Logik angedeutet habe, oberflächlich und vieles unausgeführt. Hinsichtlich des letzteren jedoch, Trawnys Empfehlung der „Frohen Botschaft“ als Heilmittel der Gegenwart, bräuchte es eingestandenermaßen dieses Werks über die Trinität bei Hegel und Schelling gar nicht. Alexander von Pechmann Dieter Wolf Der dialektische Widerspruch im Kapital. Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie, Hamburg 2002 (VSAVerlag), 474 S., 24.80 EUR. Wie jeder erfährt und weiß, begleiten den Kapitalismus auf dem Weg zu seiner aktuellen Globalisierung die Arbeitslosigkeit, die Krisen der sozialen Sicherungssysteme – vor allem des Rentensystems und der Krankenversicherung –, die Zunahme der Ungleichheit zwischen den Reichen und den Armen (im nationalen und internationalen Maßstab), weiter die Naturzerstörungen und die militärischen Expansionen. Hinzu kommen die Brutalisierung des Lebens und die allgemeine Unsicherheit der Existenz, die psychische Verelendung und die Bildungsmisere. Außerdem erfährt jeder, dass das ökonomische Wachstum des Kapitals – für das die staatliche Politik den Rahmen zu schaffen sucht – ein verselbständigter, das heißt entfremdeter Prozess ist, der mit sachzwanghafter Logik, also naturwüchsig, wenn auch nicht natürlich erfolgt. Wenn man fragt, was die Ursachen für die erwähnten Erscheinungen sind respektive welche Theorie die Erscheinungen erklärt oder wenigstens einen Beitrag zu ihrer Erklärung leistet, gewinnt die alte Theorie von Karl Marx wieder einige Aufmerksamkeit. Jedenfalls lässt sie sich nach dem Ende der Ost-WestKonfrontation unbefangener studieren. Aber kompetente Lehrer sind Neuerscheinungen kaum vorhanden, nachdem Marx auch an der Universität dem Freund-Feind-Schema zum Opfer gefallen war und man es nicht für erforderlich hielt, ihn wie Platon, Aristoteles, Kant oder Hegel gründlich zu studieren. Ein berühmter Philosoph, der über Marx öffentlich totalalisierende Urteile gefällt hatte, fragte mich vor der „Wende“ allen Ernstes, ob man von Marx’ Hauptwerk, dem „Kapital“, mehr als das erste Kapitel gelesen haben sollte. Die ersten drei Kapitel sollten es schon sein... Falls man sie liest und studiert, begreift man, dass die Verselbständung des kapitalistischen Wachstums und seine Krisen in dem dialektischen Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert wurzeln. Diesen grundlegenden Teil des „Kapital“ behandelt das hier angezeigte Buch detailliert, ausführlich und problembewusst. Die entsprechenden Kapitel haben die Überschrift: Die Wertform als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert; Der Warenfetisch und der Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert; Der doppelseitig-polarische Gegensatz von Ware und Geld als Bewegungsform des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert. Ein voran gestelltes Kapitel behandelt die gesellschaftliche Bedeutung der abstrakt-menschlichen Arbeit in nicht-kapitalistischen und in kapitalistischen Gemeinwesen. Und ein Schlusskapitel thematisiert den Begriff des Widerspruchs im „Kapital“ sowie in der „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“, verbunden mit einer Kritik an H. F. Fulda und P. Furth. Auch in den anderen Kapiteln schiebt der Autor erhellende Auseinandersetzungen mit bestimmten Theoretikern ein, nämlich mit Colletti, Henrich, Theunissen, Becker, Göhler Backhaus, Reichelt und Lange. Wie der Autor zeigt, erliegen viele Theoretiker einem „Anwendungsschematismus“, indem sie den Begriff „Widerspruch“ von außen an Marx’ Darstellung heran tragen, nachdem sie ihn zuvor von Hegel oder anderen aufgenommen haben. Dass der Autor dergleichen vermeidet und insistierend auf Marx’ Darstellungen eingeht, verdient große Anerkennung. So kann man mit seiner Hilfe auch Marx’ schwierige Wertformanalyse begreifen und hiermit die Versachlichung der menschlichen Verhältnisse (die Verkehrung von Mensch und Sache, Subjekt und Objekt). Sie ist mit der Warenproduktion notwendig verbunden; denn da die Menschen als Warenproduzenten ihre gebrauchswertproduzierende konkrete nützliche Arbeit privat bzw. abgegrenzt voneinander verausgaben (also nicht von vornherein in planvoll koordinierter Produktion vergesellschaftet sind), hat nur die in Zeit gemessene abstrakte wertproduzierende Arbeit gesellschaftlichen Charakter, und diese erscheint in dem gesellschaftlichen Verhältnis des Austauschs der Gebrauchswerte, dieser Sachen. Daher also die sachzwanghafte verselbständigte Praxis der Warengesellschaft, speziell der kapitalistischen Warengesellschaft. Elmar Treptow Neuerscheinungen Crispin Wright Wahrheit und Objektivität übers. aus dem Englischen von W. K. Köck, Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp), 305 S., 28,80 EUR. Crispin Wright ist der Verfasser zwei wichtiger Werken zu Fragen der Philosophie der Mathematik bei Frege und Wittgenstein sowie zahlreicher anderer Beiträge zur Sprachphilosophie und Wahrheitstheorie. Das Buch Wahrheit und Objektivität, im Original schon vor acht Jahren erschienen, ist charakteristisch für die Reformulierung, die traditionelle philosophische Fragen in der analytischen Philosophie erfahren und für das weite Spektrum möglicher Antworten und Argumentationsmuster, das durch diese Reformulierung eröffnet wird. Wright untersucht das Verhältnis von Wahrheit und Objektivität unter den Voraussetzungen und mit den Mitteln der modernen Realismus-Antirealismus-Debatte. Der Realismusbegriff dieser Debatte ist nicht direkt erkenntnistheoretisch (er geht also nicht der Frage nach, inwiefern der Gegenstand der Erkenntnis unabhängig von der Tätigkeit des Erkennens ist), und ist auch nicht eine Form des metaphysischen Realismus (ob wir berechtigt sind, eine vom epistemischen Subjekt unabhängige Realität anzunehmen oder ob wir zur Anerkennung der Existenz von Universalien oder abstrakter Objekte verpflichtet sind). Vielmehr handelt es sich um den semantischen Realismusbegriff, der die Relation von sprachlichen Bedeutungen und den Bedingungen der Behauptung von Sätzen (assertibili- ty) thematisiert. Eine Position ist in diesem Sinne bezüglich einer Art von Objekten realistisch, wenn sie die Kenntnis der Wahrheitsbedingungen der Aussagen über diese Objekte als notwendige Bedingung der Behauptung dieser Aussagen versteht, und in dieser Weise sich darauf festlegt, daß die Kenntnis der Bedeutung dieser Aussagen die Kenntnis deren Wahrheitsbedingungen ermöglicht. Im Gegensatz dazu ist eine Position, die sich damit begnügt, daß die Kenntnis der Bedeutung die Kenntnis der Verifikationsbedingungen oder der Verwendungsumstände der Aussagen über die Objekte einer Art ist, antirealistisch. Die Behauptung einer solchen Aussage ist nicht eine wahre oder eine falsche Behauptung, sondern kann als „angemessen“ oder als „korrekt“ bezeichnet werden. Auf der Grundlage dieser Unterscheidung wird dafür argumentiert (Dummett), daß sich erkenntnistheoretische und metaphysische Aspekte der traditionellen RealismusDebatte in Fragen über die Bedingungen der Behauptung und somit des Verstehens der entsprechenden erkenntnistheoretischen und metaphysischen Aussagen umformulieren lassen. Dieser Realismus/Antirealismusbegriff ist Voraussetzung für das Verständnis der Fragestellung von Wahrheit und Objektivität. Die Frage, die sich Wright nun stellt, ist, welche („realistischen“) Eigenschaften überhaupt durch die Wahrheit von Aussagen gefordert werden. Am Beispiel von Urteilen über das Lustige („funny“), die in gewissem Sinne als wenig „objektiv“ Neuerscheinungen empfunden werden, geht es ihm um die Charakterisierung solcher Behauptungen, die zwar im Alltag als wahr oder falsch bezeichnet werden können, die jedoch nicht in dem Sinne verstanden werden, daß sie sich auf „wirkliche“ oder „objektive“ Qualitäten der Dinge beziehen und diese abbilden. Wright sieht die Aufgabe darin, einen Wahrheitsbegriff zu entwickeln, der die Wahrheitsfähigkeit – und damit die Objektivität – von Aussagen wie z.B: „b ist lustig“ erklärt, ohne sich auf die Existenz von objektiven Eigenschaften oder Sachverhalten, denen diese Sätze „korrespondieren“, festzulegen, und ohne die Bedeutung solcher Sätze auf die Bedeutung von Sätzen über empirisch beobachtbare Sachverhalte zu reduzieren. Diesen Wahrheitsbegriff entwickelt Wright in seiner „Superassertibitätstheorie der Wahrheit“ (oder „Minimalismus“). Eine Aussage ist „superassertibel“, wenn sie berechtigt ist und bei jeder Änderung des Informationsstandes berechtigt bleibt. Ist aber „Superassertibilität“ dasselbe wie Wahrheit? Wright geht dieser Frage auf mehreren Seiten nach. Er zeigt unter anderem, daß Superassertibität jedenfalls die minimalen Bedingungen an Wahrheitsprädikate, die durch das Tarski-Schema („p“ ist wahr genau dann, wenn p) gestellt werden, erfüllt. Eine der interessanten Folgen des Minimalismus, die Wright in Kauf nimmt, ist die These von der Pluralität von Wahrheitsprädikaten, die damit begründet wird, daß die Berechtigung von Behauptungen in verschiedenen Diskursen – und damit auch die Superassertibilität von Aussagen – unterschiedlichen Kriterien unterliegt. Dies schafft ein Problem, das in der neuesten Debatte um die Thesen der Wahrheit und Objektivität aufgeworfen wurde, nämlich bei Schlußfolgerungen mit gemischten Prämissen, z.B.: „Nasse Katzen sehen lustig aus; diese Katze ist naß; diese Katze sieht lustig aus“. Da in einer Schlußfolgerung die Wahrheit von den Prämissen auf die Konklusion übertragen werden soll, und wenn tatsächlich verschiedene Wahrheitsprädikate für die Prämissen angenommen werden, scheint diese Auffassung obsolet zu sein. Der Gang der Argumentation in den Einzelfragen ist äußerst komplex und um ihm zu folgen, ist es unvermeidlich, die Originalausgabe heranzuziehen, trotz oder vielleicht gerade wegen der Bemühung des Übersetzers, an manchen Stellen den Text wortgetreu wiederzugeben. Georgios Karageorgoudis Wolf Gorch Zachriat Die Ambivalenz des Fortschritts. Friedrich Nietzsches Kulturkritik, Berlin 2001 (Akademie-Verlag), 230 S., 49,80 EUR. Die kritische Diskussion des neuzeitlichen Fortschrittsdenkens war zweifellos ein zentrales Thema der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Die Hoffnungen, die insbesondere das Zeitalter der Aufklärung in den Fortschritt der Vernunft und der Wissenschaften gesetzt hatte, wurden im Zuge dieser Diskussion zumeist verabschiedet. So diagnosti- Neuerscheinungen zieren Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung, daß der Fortschritt der Vernunft nicht in eine bessere und gerechtere Welt, sondern in die Barbarei des faschistischen Wütens und in die „verwaltete Welt“ führt. Auch postmoderne Denker wie Jean-François Lyotard sprechen von der Liquidierung des Projekts der Moderne, die für ihn durch den Namen „Auschwitz“ symbolisiert wird. Dementsprechend konzentriert sich die moderne und postmoderne Literatur über Nietzsche, in der die Auseinandersetzung des unzeitgemäßen Denkers mit dem neuzeitlichen Fortschrittsdenken untersucht wurde, vor allem auf Nietzsches Fortschrittskritik. Die solide und differenziert verfahrende Dissertation von Wolf Gorch Zachriat korrigiert diese Einseitigkeit, indem sie auch Nietzsches positive Bezüge zum Fortschrittsgedanken treffend herausarbeitet. Nietzsches Begriff des Fortschritts ist ambivalent. So weist Nietzsche einerseits die optimistische Hoffnung zurück, daß die conditio humana durch Wissenschaft und Technik grundsätzlich verbessert und die leidvollen Aspekte des Lebens überwunden werden können. Andererseits zeigt Zachriat, daß Nietzsche durchaus positive Fortschrittsvorstellungen hat, deren Verwirklichung er anstrebt. Bereits in der Geburt der Tragödie hofft er auf die Überwindung des sokratischen Optimismus durch eine von Schopenhauer und Wagner inspirierte künstlerisch-tragische Kultur, die das Leben trotz der tragischen Erkenntnis, daß das Leiden prinzipiell nicht abschaffbar ist, bejahen kann. Die Hoffnung auf den Fortschritt zu einem höheren „Grad der Kultur“ bleibt auch nach dem Tragödienbuch ein zentrales Moment von Nietzsches Denken. Eine Steigerung der Kultur kann für ihn nur von genialen Einzelnen bewirkt werden, deren Ausbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten folglich gezielt gefördert werden müssen. Der angestrebte kulturelle Fortschritt zielt letztlich auf den Aufbau einer modernen „geistig-leiblichen Aristokratie“, deren Architekten die freien Geister sein sollen. Zachriat kann auch zeigen, daß Nietzsche nicht dafür plädiert, daß sich der Einzelne mit dem Nihilismus abfinden soll, sondern seine kritische Überwindung intendiert. Nietzsche strebt tatsächlich einen Fortschritt aus dem Nihilismus an, den er, anders als etwa Gianni Vattimo meint, sowohl für möglich als auch für wünschenswert erachtet. Zachriat beginnt seine Dissertation mit einem instruktiven Kapitel, in dem er den Gehalt und die Geschichte des Fortschrittsbegriffs darstellt. Es folgen ein Kapitel über die Geburt der Tragödie, eines über die Unzeitgemäßen Betrachtungen und eines über die mittleren bzw. freigeistigen Schriften bis 1881 (Erscheinungsjahr der Morgenröte). Hier bricht Zachriats Untersuchung von Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsgedanken ab. Es folgt lediglich eine stilistisch etwas verunglückte Zusammenfassung und ein sehr kurz geratener Ausblick auf das Spätwerk. Zwar ist eine derartige Eingrenzung der Fragestellung grundsätzlich nicht zu bemängeln. Allerdings geht diese weder aus dem Titel noch aus dem Werbetext hervor, der sogar suggeriert, daß in der Neuerscheinungen Arbeit auch das Spätwerk untersucht wird. Die von Zachriat kurz thematisierten Probleme des Spätwerkes, etwa ob die anti-progressive Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen mit Nietzsches progressiven „Lehren“ einer Umwertung aller Werte und eines Überganges zum Übermenschen vereinbar sind, würden eine weitere Untersuchung rechtfertigen, die ein Desiderat für künftige Forschungen bleibt. Manuel Knoll Stefan Zenklusen Adornos Nichtidentisches und Derridas différance Berlin 2002 (Wissenschaftlicher Verlag), Pb., 131 S., 16.- EUR. Ein Jahr nach der Vergabe des Theodor-W.-Adorno-Preises an Jacques Derrida erscheint im Wissenschaftlichen Verlag Berlin eine Parallelisierung Theodor W. Adornos mit Jacques Derrida. Verfasser ist der in Zürich domizilierte freie Autor, Philosoph und Romanist Stefan Zenklusen. Seine Sympathie macht Zenklusen im Untertitel explizit, in dem er für eine „Resurrektion negativer Dialektik“ plädiert. Zenklusen schält am Leitfaden des Themenkomplexes Identität und Differenz anhand der NichtBegriffe „Nichtidentisches“ und „différance“ heraus, was beide Denker eint und trennt. Auf die passagenweise vielleicht etwas dichte und überladene Exposition des Differenzdenkens beider folgt der eigentliche Gegenüberstellungsteil. Zenklusen wundert sich über fehlende Bezüge zu Adorno im Werk Derridas (wo der Schriftbegriff omnipräsent ist), angesichts der Rolle, die bei jenem nicht nur das Unsagbar-Nichtidentische, sondern auch (vor allem in der Ästhetik) der Spielund Schriftbegriff spielt. Metaphysik „im Augenblick ihres Sturzes“ erheischt bei Adorno bekanntlich eine negative Dialektik, die das „Dasein ihrer Elemente“ zu einer Konfiguration bringen würde, in der die Elemente „zur Schrift zusammentreten“. Während Adornos Nichtidentisches als utopisches Regulativ sozioökonomischer Asymmetrien und ihrer Folgen für Mensch und Natur fungiert, verlegt es Derrida in die unauslotbare, differenzermöglichende Bewegung der „différance“ selbst. Die Nähe der „différance“ zum „Seyn“ des späten Heidegger wurde, so Zenklusen, in der Literatur bisher zu wenig herausgestrichen. Aus dieser Verwandtschaft erklärt sich Derridas viszerale Ablehnung jedes Essentialismus. Adornos Rede vom „verkehrten Wesen“ müsste so aus Derridas Sicht zwangsläufig einen dekadenztheoretischen Rückfall in einen Humanismus bedeuten. Die Entsprechung zu Adornos Bilderverbot ist Derridas Definitions- und Begriffsverweigerung, die allerdings ebenfalls Heidegger’sche Züge trägt: Die „différance“ schreibt er manchmal, wie der späte Heidegger das „Sein“, kreuzweise durchgestrichen. Wo bei Adorno Philosophie und Kunst in deren Wahrheitsgehalt konvergieren, scheint Derridas „Wahrheit“ in der Unmöglichkeit jedes fixierbaren Gehalts überhaupt Neuerscheinungen zu bestehen. Das wäre für Adorno, der Dialektik gegen sich selbst wendet, ohne sie aber aufzulösen, Hypostasis des Aporetischen. Zenklusen weist die These von der Dekonstruktion Derridas als einer Überwindung oder Radikalisierung negativer Dialektik zurück: „Der Verantwortung historischer Kontextualisierung entzieht sich Derrida durch den Hinweis, das Denken von ‚Geschichte’ werde durch die différance überhaupt erst ermöglicht.“ Derridas Fundamentalsemiologie erweise sich methodisch als eigenartiger, dem Rationalismus abholder Rationalismus, der den Strukturalismus zu verwinden vorgibt, ihm aber im binären Schematismus und der Zeichenverhaftetheit unfreiwillig treu bleibt. Die Probleme und Gefahren, die auftauchen, wenn durch „entwirklichende Spiegelfechterei“ alles in Frage gestellt wird, die Begriffe zu Spielmarken werden, die in inhaltsarmer Opposition zueinander gebracht werden und die Differenz zum Selbstzweck wird, hat Adorno erkannt. Deshalb fällt Derrida, so Zenklusen, in gewisser Weise Im anschließenden hinter Adorno zurück. ethischpolitischen Teil kritisiert Zenklusen Derridas Haltung zu Heideggers kurzem Engagement als Rektor der Freiburger Universität als „Gänsefüsschen-Dekonstruktion mit Samthandschuhen“. Origineller sind sicherlich Zenklusens gegenwartsdiagnostische Miszellen, die den Band beenden. Sie sind teilweise von einem etwas düsteren Ton geprägt, verraten aber ein feines Sensorium für die derzeitige politische, sozioökonomische und kulturelle Entwicklung. Seine eigenen Analysen verwebt Zenklusen mit Adornos Antizipation des „drohenden liberal-libertiziden Totalitarismus“, der etwa von Jürgen Habermas wegen der weitgehenden Unantastbarkeit des „Systems“ kaum mehr problematisiert werden kann: „Die Versuche, negative Dialektik als Muster intellektueller Selbstverständigung einer vergangenen Epoche oder als ästhetisches Lebensverbringungsreservat zu verharmlosen, sind unhaltbar.“ Daniel Huber