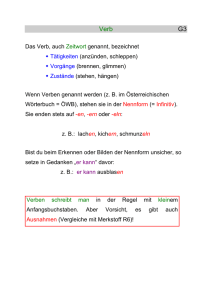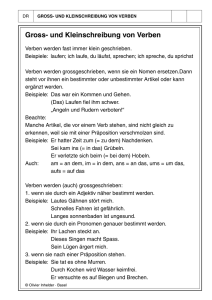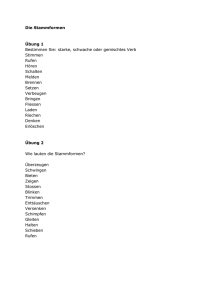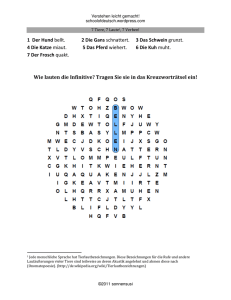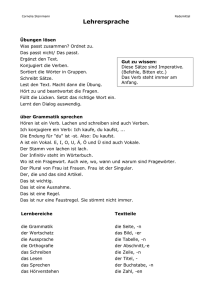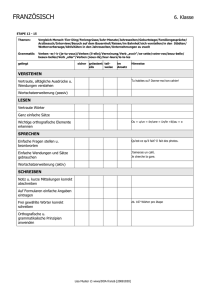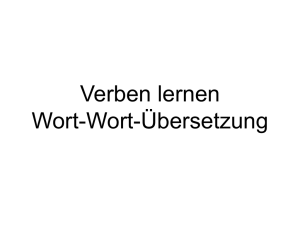Eichinger_Schumacher_(Hg.)
Werbung

Rezensionen eine interdisziplinäre Nische abgeschoben werden, sondern neben die großen germanisti­ schen Sachlexika gestellt werden: neben den alten und neuen H o o p s ’ , neben das Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte und das Lexikon des Mittelalters. In dieser Nachbarschaft wird es seinen Wert als historiographisches Grundlagen werk entfalten können. Es bleibt den Herausgebern und dem Verlag zu wünschen, daß sie das H RG in den 1990er Jahren abschließen können und daß es gelingt, das Werk durch Register zusätzlich zu er­ schließen. Wünschenswert sind ein Register historischer Rechtswörter, ein Autorenregister (wer hat welchen Artikel verfaßt?), ein Sachregister der Artikel und ein vollständiges Quel­ len- und Literaturverzeichnis. Dies würde gerade den Benutzern aus fachlicher Nachbar­ schaft viele weitere Zugänge in das Werk eröffnen. Erlangen H o r st H a id e r M u n sk e 1 H o o p s , J o h a n n e s : Reallexikon der Germanischen Alterstumskunde. Bd. 1-4. Straß­ burg 1911-1919. - Zweite, völlig neu bearb. und stark erweiterte Aufl. Bisher: Bd. 1-7. Berlin 1973-1989. [Erste Lieferung: 1968]. H e l m u t S c h u m a c h e r ( H g .) : Verben in Feldern. Valenzwörterbuch zur Syntax und Se­ mantik deutscher Verben. Berlin/New York: Walter de Gruyter 1986. XXIV, 882 S., aus­ klappbares Abkürzungsverzeichnis. (Schriften des Instituts für deutsche Sprache. Bd. 1). Nach dem „Kleinen Valenzlexikon deutscher Verben” aus demselben Hause kann man „Verben in Feldern“ als den Versuch verstehen, das Beste mehrerer Welten miteinander zu vereinen. Das immer noch nicht unproblematische Valenz-Konzept tritt in den „Verben“ etwas in den Hintergrund, gleichzeitig werden die Verbindungen innerhalb des Lexikons deutlicher herausgehoben: „in Feldern". Nicht nur der gegenüber der ersten Mannheimer Aufstellung gewaltig vermehrte Umfang und die erhöhte Seriosität der Aufmachung beein­ drucken den, der das Buch erstmals in die Hand bekommt, auch und gerade die Zunahme des Artikelumfangs, die gesteigerte Genauigkeit der Beschreibung. Besonders auffällig ist dabei die onomasiologische Grundgliederung, der auch daran schon erkennbare erhöhte Wert der Bedeutungsbeschreibung. Das hängt natürlich mit dem Anspruch zusammen, hier ein produktionsorientiertes Wörterbuch zu liefern; dabei ist die Auswahl der Verben und die Beschreibung ihrer Verwendung außerdem von den Bedingungen eines allgemeinen wissen­ schaftlichen Sprachgebrauches geleitet. Diese kommunikative Variante soll beschrieben wer­ den, Benutzer-Zielgruppen sind Lehrkräfte und fortgeschrittene Lerner des Deutschen als Fremdsprache. Unter diesen Voraussetzungen werden „Über 1000 Verben und verbale[n] Ausdrücke[n]" (S. 1) [428 Lemmata und 573 feldzugehörige Verben (S. 9) = 1001 Lexeme < ! > ] dargestellt, wobei es hierarchisch von Makrofeld über Verbfeld, Subfeld, Verbgruppe zur Subgruppe und letztlich zum einzelnen Verb geht. Behandelt werden die Makrofelder: 1. Verben der allgemeinen Existenz, 2. Verben der speziellen Existenz, 3. Verben der Differenz, 4. Verben der Relation und des geistigen Handelns (mit 15 Untergruppen [!]), 5. Verben des Hand­ lungsspielraums, 6. Verben des sprachlichen Ausdrucks und 7. Verben der vitalen Bedürfnis“ se. Das immer als prekär geltende Problem der Abgrenzung von Ergänzungen und Angaben wird im Praktischen durch einen gewaltigen Boom von fakultativen Ergänzungen gelöst. Bei vom Verb implizierten Elementen wird geprüft, „ob die Bedeutung des jeweiligen Verbs nur erklärt werden kann, wenn in der Paraphrase auf die Variable Bezug genommen wird, die das Z eitschrift für D ialektologie und L in g u istik , L V IIl. Jah rg an g , H e il 2 (1991) © Franz. Steiner V erlag W iesbaden G m b H , S ilz Stuttgart 210 Rezensionen fragliche Satzglied vertritt" (S. 21). Wenn die so getroffenen Abgrenzungen auch nachvoll­ ziehbar erscheinen, muß man sich allerdings klar sein, daß die mit ihnen verbundene Infla­ tion von fakultativen Ergänzungen die Gefahr in sich trägt, die angesprochene grundsätz li­ ehe Unterscheidung der Valenzgrammatik aufzulösen, damit auch den Charme ihrer didakti­ schen Einfachheit anzugreifen. Was kein wichtiges Argument wäre, stünde nicht dahinter eine mangelnde Unterscheidung dessen, was textsemantisch und was satzsyntaktisch ver­ langt ist. Die folgende Aufgliederung der Ergänzungsklassen birgt wenig Überraschungen, viel­ leicht kann man bedauern, daß es nicht gänzlich möglich war, sich mit der inhaltlich wie institutioneil benachbarten Grammatik von U l r i c h E n g e l (1988) auf ein einheitliches In­ ventar zu einigen. Dabei ist die hier vorgeschlagene Adverb-Ergänzung zweifellos die im Rahmen des Gesamtmodells konsistentere Lösung (S. 29 f.). Die angesprochene Abgrenzung der fakultativen Ergänzungen bedingt dann eine relativ starke Diskrepanz zwischen den Satzmustern und den Satzbauplänen, bei denen die Fakultativität der Mitspieler berücksich­ tigt wird (s. S. 34-35). Großer Wert wird in diesem Wörterbuch auf die Kontrolliertheit der Bedeutungsregeln gelegt; das gilt sowohl für das in den Paraphrasen verwendete Beschreibungsinventar wie für die Formulierung der Kombinationsbeschränkungen als Bedeutungspostulate, d.h. als vom Verb ausgehenden Relationen. Dabei ist die in den Paraphrasen gewählte Beschreibungsspra­ che zum Teil in einem entsprechenden Anhang erläutert, zum Teil wird auf das Vorwissen des Benutzers verwiesen (s. S. 821). Unverkennbar steckt hier ein gewisses Problem: die Bedeutungsbeschreibungen erläutern zwar für die spezielleren Verben die angenommene Feldstruktur, bei den grundlegenden Verben der jeweiligen Felder führen sie aber leicht in eine Allgemeinheit, die ihren Nutzen zumindest im Hinblick auf die intendierte Benut­ zungssituation in Zweifel ziehen läßt. Vermutlich wäre es sinnvoller gewesen, öfter wie bei es gibt (S. 74) einfach auf den überhaupt höchst nützlichen Vorspann zu den einzelnen Feldka­ piteln zu verweisen. Gerade bei den „Verben der allgemeinen Existenz", deren archetypi­ schen Fall dieses Verb darstellt, hat die Bedeutungsparaphrase bis auf stilistisch diskriminie­ rende Anmerkungen wie 'gehoben*, 'formell* keinerlei unterscheidende Wirkung. Das kann auch nicht anders sein, hängt doch die Abgrenzung zu den benachbarten Verben der speziel­ len Existenz daran, daß die Belege nur so gedeutet werden dürfen, daß die regelmäßig auftretenden Lokal- oder Temporal-, ersatzweise Modalbestimmungen als „hinzugefügte Lokal- bzw. Temporalangaben“ (S. 74) interpretiert werden. N ur als außerordentlich bedau­ erlich kann man es empfinden, daß gerade die Belege, die für das in beiden Gruppen einge­ führte Verb existieren einen entsprechenden Verwendungsunterschied nahezulegen versu­ chen, ausschließlich auf in ihrer Herkunft nicht kenntlich gemachte Beispiele fraglicher Akzeptabilität rekurrieren (Gott existiert; Einhörner existieren nicht), wahrend der einzige mit Quellenangabe versehene Beleg auch zu seiner grammatischen Akzeptabilität unbedingt die modale Bestimmung (nebeneinander) benötigt. Unklar bleibt auch, wie etwa „in der Regel über Kontextinformation“ (S. 162) zu differenzieren wäre zwischen der angenomme­ nen speziellen Existenzsituierung in „Eineprivate Dentistenschttle existierte in Baltimore seit 1840.“ und einem, wie es scheint, um nichts davon unterschiedenen Satz „Eine private Dentistenschule gab es in Baltimore seit 1840.a Was nichts daran ändert, daß beide Verwen­ dungen deutlich weniger lokal sind als die folgenden Verben der speziellen Existenz. Daher umreißt auch hier die einheitliche Bedeutungsparaphrase nur noch einmal die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Subgruppe des verbalen Feldes. Erfreulich ist die Bemühung, die Gebrauchsvarianten so weit wie möglich zu dokumentie­ ren, nicht so sehr gefallen kann, daß gerade kritischere Verwendungen gar nicht oder mit konstruierten Beispielen belegt sind. Das gilt zum Beispiel für die Zustands-Passiv-Belege Rezensionen 211 von produzieren (S. 114), anfertigen (S. 117: Die Initialen dieser Handschrift waren mit Blattgold angefertigt.), zustande bringen (S. 124), hervorbringen (S. 125), produzieren 2 (S. 128), auslösen (S. 135), hervorrufen (S. 135), vernichten (S. 144) u.v.a. (vgh dazu die ent­ sprechende Erklärung S. 40). Wie oben schon festgestellt, ergeben sich entsprechende, systematisch bedauerliche Lükken bei den Belegen, die die Fakultativität von Ergänzungen zeigen sollen. Besonders auffäl­ lig ist das etwa bei übriglassen (S. 146-147), wo die fakultative Ergänzung nur in Belegen auf taucht, deren Herkunft nicht gekennzeichnet und bei denen der Skopus der in Frage stehenden partitiven von “Phrasen zudem unterschiedlich ist: Der Angriff hat vom D orf nur die Kirche übriggelassen, vs. Der Sturm hat kaum etwas von der Ernte übriggeLxssen. D.h. bestimmte Besetzungen der Akkusativergänzung erlauben die scheinbar selbständige Hinzufiigung des Bezugsrahmens als geniti vus partitivus (vgl. ähnliche Regularitäten vom Typ Er ist mit dem Gesicht a u f die Erde gefallen). Auch hier scheint nicht hinreichend bedacht, was der Unterschied zwischen lexikalischer und textueller Valenz sein könnte (vgl. die andere Handhabung solcher partitiver twi-Phrasen z.B. bei trinken). Dasselbe gilt wohl für Fälle wie das zweifellos schwierige Verb dd-sein (S. 184-185), wo ja eigentlich das da- schon die örtliche Bestimmung „in y" der Bedeutungsbeschreibung „es gibt x in y “ abdeckt. Tatsäch­ lich zeigt keines der Beispiele - in diesem Fall lauter „echte“ Belege - eine Solche Bescirn^ mung: hier kann die textsemantisch wohl nötige lökale Bestimmung innerhalb des Satzes gar nicht realisiert sein. So hätte man dafür doch gerne auch auf der Ebene der syntaktischen Valenz eine andere Beschreibung als z.B . für das unmittelbar folgende anwesend sein (S. 185) [ähnlich: es fehlt an (S. 188-189); vorliegen (S. 192)]. Offenkundig führt die zu wenig von der empirischen Verteilung auf Satz und Text gesteuerte theoretische Ableitung der fakul­ tativen Ergänzungen zu intuitiv nicht immer befriedigenden Beschreibungen (gilt etwa auch von der Gleichsetzung der beiden möglichen präpositionalen Bestimmungen bei sich entwikkeln (S. 246-247) oder sich verwandeln (S. 248), die nur unter sehr speziellen Bedingungen miteinander auftreten). Zum Teil scheint auch ein fachsprachliches Maximum angesetzt, bei dem die Frage der Implikation der Ergänzungen nur schwer nachzuvollziehen ist (etwa die mtf-Phrase bei sich vergrößern (S. 286), die auch bei keinem Beispiel belegt ist; ähnlich in z bei Zusammenhängen mit (S. 378)). Auch sonst irritieren manche syntaktischen Einschätzun­ gen; was heißt es, wenn von Sätzen wie D er Junge ist aufgeweckt, gesagt wird, hier würden „Passivsätze im Sinne einer anderen Bedeutung interpretiert" (S. 790)? Durch die Beschränkung auf Verben, die einer „allgemeinen Wissenschaftssprache“ zuge­ hörten, treten natürlich regionale und sonstige Varianten in den Hintergrund. Nicht überra­ schend tst allerdings, daß gerade in der Gruppe 7 der Verben der vitalen Bedürfnisse, die sich ohnehin kaum der allgemeinen Wissenschaftssprache anbequemen dürften, Markierungen zum Stilwert in erklecklicher Anzahl auftauchen. So gelten z.B . kriegen, eindösen, fressen in D er Wagen frißt viel Bemin. (warum übrigens bei saufen nicht entsprechend: der Wagen säuft (viel Benzin)}) als [umgangssprachlich], saufen2 und fressen 3 als [derb], verzehren oder speisen als [gehoben] usw. Die regionale Differenzierung kommt hauptsächlich im jeweiligen Feldvorspann vor. Im Stichwort (sichakk) verschlafen/ findet sich allerdings z.B. die Anmer­ kung, das Verb werde „nur regional, z.B. im ripuarischen Sprachraum, mit Reflexivprono men verwendet“ (S. 795). Als regional gekennzeichnet werden in den Vorspannteilen ohne genauere regiolektale Differenzierung etwas probieren vs. etwas kosten (S. 762) und weitere Essensverben wie vespern oder Abendbrot/zu Nacht essen (warum nicht abendessen?), auch verschiedene Verben des Stehlens (S. 737). Es ist erklärlich, daß Regionales in einem Wörter­ buch der vorliegenden Art keinen systematischen Platz findet, klar sollte allerdings auch sein, daß ediche der als „salopp“ oder „salopp umgangssprachlich“ gekennzeichneten Lexe­ me auch als regional differenziert anzusehen sind. Das scheint mir etwa für pennen (S. 790) 212 Rezensionen zu gelten. Das Merkmal fachsprachlich, das auch gelegentlich vergeben wird (etwa iür pach­ ten), sollte systematischer verwendet werden, um fachsprachliche und sonstige text­ sortenspezifische Varianten von eher alltagssprachlichen abzusetzen: das betrifft vermutlich doch viele der fakultativen Ergänzungen z.B . bei den Anderungsverben. Diese mangelnde Gebrauchsdifferenzierung und die wenig textsensitive Art der Bestimmung von fakultativen Ergänzungen sind vermutlich aus valenzsyntaktischer Sicht die Dinge, die am ehesten weite­ rer Überlegung bedürfen. Beeindruckend und ein Fortschritt, der die Valenzlexikographie des Deutschen auf eine neue Basis stellt, ist das onomasiologische System, das in diesem Buch ausgebaut vorliegt, und das Vorliegen einer Beschreibung, die auch auf semantischer Ebene sogar unter Gesichtspunkten der Satzproduktion brauchbar erscheint. Passau L u d w ig M. E i c h i n g e r W a l t e r H a a s : Jacob Grimm und die deutschen Mundarten. Stuttgart: Franz Steiner 1990. X II, 95 S., 36 Abb. (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. N. F. N r. 65). Angesichts der thematischen Vielfalt, der methodischen Innovationen und der enormen Intensität der Stoffdurchdringung in der Forschungsarbeit J a c o b G r i m m s erhebt sich die Frage, inwiefern das Interesse dieses hervorragenden Repräsentanten einer neuen Phase der sprachwissenschaftlichen Germanistik1 für die Mundarten tatsächlich — wie weithin ange­ nommen - nur sekundärer Art gewesen ist. Dieser wissenschaftsgeschichtlichen Problematik wandte sich W a l t e r H a a s bereits 1985 im Rahmen einer Vortragsreihe zum BrüderG R iM M -Jah r zu. Nunmehr sind die Ergebnisse seiner Untersuchung in einem sorgfältig edierten Beiheft der Z D L nachzulesen. Des Autors Absicht kann nicht darin bestehen, die Urteile der Zeitgenossen und Späteren (Anhang 3, S. 83 ff.) zu diesem Aspekt des G R iM M sch en Wirkens zu revidieren. Wohl aber ist es W. H a a s in subtiler Interpretation der wichtigsten Äußerungen J a c o b G r i m m s zur Problematik möglich, dessen Position detaillierter und vor allem differenzierter zu bestim­ men, so daß nicht zuletzt die völlig andersartigen Grundlagen der Dialektologie n ach J a c o b G r im m deutlicher in Erscheinung treten. Ausgehend von einer Charakteristik des Hintergrundes für J. G r im m s linguistische Ar­ beit, seiner „buchstabenphilologische[n] Veranlagung" (S. 13) und vermutlich geringen mun­ dartlichen Kompetenz, behandelt Verf. im zweiten Abschnitt dessen Verwendung der Aus­ drücke „Dialekt“ und „Mundart“. Bei insgesamt poetisch-ambigem Terminologiegebrauch wird eine weitestgehende Synonymität beider Begriffe in dem vagen Sinne von 'Teilsprache irgendwelcher (historisch geprägter) Ordnung’ ermittelt, wobei die als „Volksmundarten“ bezeichneten modernen Mundarten der Dialektologie für J. G r im m wohl vorwiegend durch ihre Gebundenheit an sozial niedrige Schichten gekennzeichnet sind. Dem Verhältnis von Mundart und Schriftsprache wird in einem dritten Abschnitt nachge­ gangen. Während für J. G r i m m alle modernen Varietäten in formaler Hinsicht „gesunken“ , d.h. sinnlicher Sprachqualitäten verlustig gegangen sind, entsteht infolge des Wirkens der Dichter bzw. der Poesie auf die Schriftsprache der grundlegende formale Unterschied zu den Mundarten, die sich ohne die belebende Wirkung der Literatur nicht mehr in sinnlichintellektuellem Gleichgewicht befinden. Seiner Auffassung nach sind beide Sprachformen 1 W e r n e r N e u m a n n (1985), in: Sprachwissenschaftliche Germanistik. Ihre Herausbil­ dung und Begründung. Hg. von W e r n e r B a h n e r und W e r n e r N e o m a n n . Berlin. S. 125 ff. Zeitschrift für D ialektolo gie und L in g u istik , LV I1I. Ja h rg an g , H e ll 2 (1991) © F ran z Steiner V erlag W iesbaden G m b H , S ilz StmtgaM